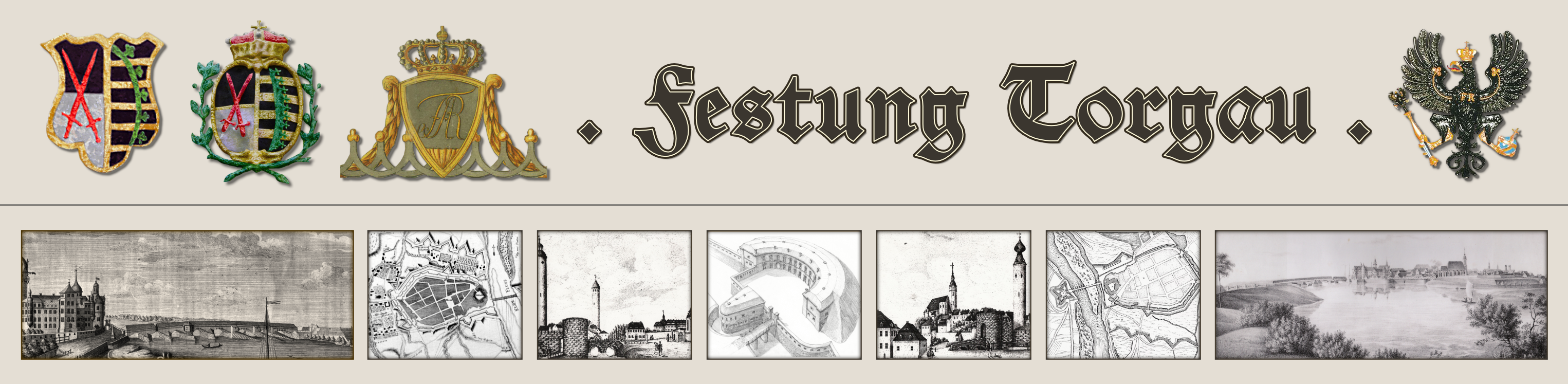
Sachsen, Preußen und Napoleon
Tagungen auf Schloß Hartenfels
Einige bearbeitete Inhalte der Podiumsdiskussionen, 2011–2013
von
Dr. Uwe Niedersen
1. Sachsen, Preußen und Napoleon
Sachsen und Preußen, die 1806 gemeinsam gegen Napoleon marschierten, gingen nach der erlittenen Niederlage bei Jena und Auerstedt getrennte Wege. Sachsen wurde durch den französischen Kaiser vereinnahmt und bestimmt.
Preußen blieb zu Frankreich auf Distanz.
Diskutiert wurde die mitunter illusionäre Neutralitäts- und die schwankende Bündnispolitik des sächsischen Hofes. Eine Flankierung der sächsischen Staatspolitik und der dazugehörigen Diplomatie durch das Militär, in anderen Staaten Grundlage der jeweiligen Stabilität, sollte in Sachsen nicht gelingen. Misserfolge waren unausweichlich.
Preußen gelang es, sich wieder aufzurichten, vor allem durch wirksame Reformen und eine gelungene Bündnispolitik. Das nach der Niederlage von 1806 reformierte preußische Militär und die Einbeziehung aller Bevölkerungskreise während der Befreiungskriege erwiesen sich als förderlich.
Mitunter wurde ein Vergleich zwischen dem Sachsen Thielmann und dem Preußen Yorck versucht. Tatsächlich kamen dabei Seiten einer möglichen Vergleichbarkeit zum Vorschein, die aber wiederum Elemente der Unvergleichbarkeit beider Persönlichkeiten zu Tage treten ließen.
Vergleichbar und zugleich unvergleichbar waren weiter die beiden Höfe, der in Sachsen und der in Preußen, sowie auch das Erscheinungsbild, welches die Untertanen beider Königreiche bei der Überwindung der französischen Fremdherrschaft lieferten.
Zurückgeblickt wurde auf das Sachsen, das sich hinsichtlich der Vormachtstellung in Mitteleuropa bereits über hundert Jahre in einen Wettstreit mit Preußen befand und 1815 scheiterte. Und dennoch! Das „Rest-Sachsen“, etwa in den Grenzen des ehemaligen albertinischen Territoriums, erwies sich als ein prosperierender Staat und zwar bis in die Gegenwart.
Eine Anmerkung zum Verhältnis von Sachsen zu Napoleon: Ein solches, wenn man sich unter „Verhältnis“ etwas Ausgewogenes vorstellt, gab es eigentlich nicht. Der sächsische König Friedrich August I. konnte mit seiner Außenpolitik, die sprichwörtliche „sächsische Neutralität“, nicht behaupten oder sie gar durchsetzen.
Trotz Niederlagen, Demütigungen sowie Verlust und Leiden im bürgerschaftlich-zivilen Leben gab es nirgendwo eine treuere Anhänglichkeit dem Herrscherhaus gegenüber, als es bei den sächsischen Untertanen zu verzeichnen war.
2. Festung und Feldschlacht – neue Erkenntnisse
In den Podiumsgesprächen sind die Festungen an der Mittleren Elbe in ihrer Funktion zu den Feldschlachten in Sachsen (1813) angesprochen worden; sowohl die Festungen im Einzelnen als auch die Festungen im Verbund.
Folgende Aussagen wurden getroffen: Napoleon hatte die Elbbefestigungen zu Kampagne-Festungen in Verbindung mit dem Konzept „doppelter Brückenkopf“ so umfunktioniert, dass dabei eine hohe Beweglichkeit seiner Truppen zustande kam und zwar gleich dreifach: erstens bei den Elbüberquerungen selbst, zweitens beim Nachsetzen von über den Strom gegangener feindlicher Militäreinheiten und drittens beim beschleunigten Aufmarschieren der eigenen Armeen in die jeweilige Feldschlacht.
Befestigungen, so Napoleon, seien als vorübergehende Bauten anzulegen und zwar die Offensive der eigenen Feldtruppen unmittelbar unterstützend.
Selbst der Preuße Helmuth von Moltke nutzte in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts noch die Erkenntnisse und Erfahrungen Napoleons hinsichtlich gedeckter, wechselseitiger Flussüberquerungen („doppelter Brückenkopf“) und der daraus resultierenden hohen Mobilität und Offensivkraft der Truppe.
3. Speziell zur Festung Torgau
Erstmals konnte eine Bestimmung der sächsischen Festung Torgau hinsichtlich ihres Standortes, ihrer Struktur und ihrer Funktion von 1806 bis 1815 vorgenommen werden. Außerdem ist ein Wissenszuwachs über die Rolle der Festung Torgau unter dem Kommandanten Thielmann in jener hoch sensiblen Zeit erzielt worden: Sachsen und seine Bündnisalternativen in der Zeit von Februar bis Mai 1813.
Torgau wurde von den sächsischen Ing.-Offizieren (Aster; Le Coq) gemäß des Anliegens, hier die Elb- und Landesfestung Sachsens zu errichten, großflächig und komplex in der Gestalt, als eine, auch in Friedenszeiten dauerhaft zu betreibende, defensive Befestigung konzipiert. Der dann aber alles bestimmende Befehl Napoleons zielte auf das genaue Gegenteil: Torgau musste zu einer offensiven und baulich „ausgedünnten“ wie flächenmäßig eingeengten („Kampagne-„) Festung gebaut werden.
Aufgrund der in der Stadt Torgau 1813 ausgebrochenen Typhus-Epidemie mit beinahe 30.000 Toten war die Festung weder als „offensive“ Fortifikation zur Unterstützung der Kampagne der napoleonischen Feldtruppen noch als ausgedehnte, komplexe und defensiv angelegte, d.h. Truppen, Verwundete und Seuchen-Kranke aufnehmende Landesfestung verwendbar.
Die Festung Torgau konnte nach dem grundsätzlichen Eingriff Napoleons weder die eine noch die andere Funktion erfüllen.
4. Bemerkungen zur „Torgau-Geschichte“
Das sächsische Torgau war nach 1815 preußisch geworden. Mit der Wende, 1990, kehrte per demokratischer Abstimmung die Stadt in den sächsischen Staatsverband zurück (dafür waren über 90% der wahlberechtigten Bürger).
Angemerkt werden muss aber, dass die Geschichtsschreibung über Torgau nach dem Wiener Kongress, aus dem sächsischen Torgau war ja ein preußisches geworden, zwei Jahrhunderte lang, sowohl durch die Preußen als auch durch die Sachsen, vernachlässigt worden war. Für Torgau fühlte sich kein Historiker mehr so richtig zuständig.
So ist es heute besonders begrüßenswert, dass die durchgeführten Tagungen sowie der vorliegende Sammelband „Sachsen, Preußen und Napoleon“ bisherige Versäumnisse und Auslassungen in der Torgauer Militär- und Festungsgeschichte mit beseitigen hilft.
Dass mit der Behandlung der Napoleonzeit die Wiederaufnahme der Geschichtsschreibung über Torgau durch die Tagungen auf Schloß Hartenfels sowie durch den Sammelband mit unterstützend vollzogen wurde, hängt auch mit der Organisation des Projektes zusammen.
So haben wir als Förderverein Europa Begegnungen e.V. eben nicht von anderen Institutionen, etwa von Universitäten und Akademien, die durchgeführte Tagungen importiert, d.h. Tagungen als „Fertigprodukt“ in den Tagungsort Torgau uns hinein legen lassen, wie es in der Stadt normalerweise praktiziert wird. Wir selbst waren es, die die Konzeption und die dafür unterlegte Theorie und Methode erarbeiteten und das Konzept europaweit versandten. Zuspruch und Unterstützung von Außen gab es zuhauf. Es meldeten sich Fachvertreter ersten Ranges, die auf der Grundlage des von uns erstellten „Kursbuches“ in den „Tagungszug“ einstiegen und hier in Torgau vorgetragen haben.
5. Napoleon und Europa
Wie zeigte sich das Europa mit seinen Einzelstaaten während der Napoleonzeit?
Durch die Eroberungen Napoleons in Europa und der anschließenden französischen Verwaltung der besetzten Gebiete hatte sich so etwas wie ein europäisches „Napoleon-Imperium“ herausgebildet. Dieses „europäisch-napoleonische Besatzungsgebiet“ zeigte sich besonders nach 1812 als deutlich instabil, und musste von Anfang an durch eine strenge französische Fremdherrschaft zusammen gehalten werden.
Es trat die Frage auf, ob eigentlich in dem besagten frankophilen Europa noch etwas für die heutige Situation der europäischen Staaten Förderliche abgewonnen werden könne?
Die Frage wurde kontrovers beantwortet.
Fazit: Ob sich da etwas Ableitbares ergibt, etwas, was sich sogar für das heutige Europa als tauglich erweist, sollte den in dieser Richtung in Versuchung Gekommenen überantwortet werden.
Wer da, mit welchem „Europablick“ auch immer, lange genug in die historischen Zusammenhänge hineinschaut oder gar zu suchen beginnt, der wird auch Ableitbares oder Analoges zu dem derzeitigen Europa finden.
Der Nachteil ist nur, wer hierbei die „Optik überdreht“, der wird viele andere Erzähl-Ebenen der Geschichte, möglicherweise die interessanteren, gar nicht wahrnehmen können.
Wer meint, er habe aus der Geschichte Ableitbares für das Heute gefunden, sollte, um glaubwürdig zu bleiben, in dem gleichen Zusammenhang auch über Nicht-Ableitbares sprechen.
Es bleibt wohl weiter zweifelhaft, ob überhaupt und wenn doch, mit welchem Nutzen die Menschheit aus der Geschichte lernen kann.
6. Die Autoren des Buches und über das Schreiben von Geschichte
Die Autoren des Buches gehören zum einen der Gilde der Fachhistoriker an, die an den Universitäten und Forschungsinstituten tätig sind oder waren. Zum anderen sind es Enthusiasten der Heimatgeschichte gewesen, welche sich autodidaktisch Kenntnisse über die zu behandelnden Gegenstände, über die Vergangenheit ihrer Städte und Regionen erarbeiteten. Es sind weiter Spezialisten der Festungsforschung und Militärgeschichte zu nennen, die alle untereinander einen Zugang zum jeweils anderen fanden.
Ein heute mitunter beklagtes Auseinanderdriften von Geschichtswissenschaft und interessierter Öffentlichkeit konnte während der Torgau-Tagungen zu keinem Zeitpunkt beobachtet werden. Es gab keine Kluft zwischen den Historikern und der Bürgerschaft.
Alle in das Torgauer Buch-Projekt einbezogenen Referenten und Autoren waren sich darin einig, die Geschichtsschreibung im traditionellen Sinne, d.h. historiografisch vorzunehmen. Geschichte wird erzählt. Denn das, was verstanden werden will, muss erzählbar sein.
7. Die Geschichtsschreibung ist „offen“ zu halten, mit anderen Worten „Geschichte ist ein Menschenrecht!“
Folgendes war den Gesprächen zu entnehmen:
Für den heutigen Menschen gibt es nichts Interessanteres, als zu erfahren, wie historische Personen lebten.
Weiter ist erkannt worden, dass Personen und Gruppen in der Geschichte nicht gesetzmäßig, ausschließlich materiellen Interessen gemäß vorgehen; somit ist eine gesetzmäßige Vorausbestimmbarkeit menschlichen Handelns nicht gegeben.
Es gibt an Einflussfaktoren gar viele.
Primär handeln historische Personen aus Angst, Liebe, Hass, Eitelkeit, Machtbedürfnis, Ruhmsucht. Sie agieren meist widersprüchlich, zufällig, irrational.
Die Nähe am „Wie es wirklich war“, d.h. das Streben nach Objektivität ist die natürliche Grundlage des entworfenen Geschichtsbildes und somit Kriterium für die Wahrhaftigkeit der erzählten Geschichte.
Dennoch: Alles Erzählte ist von Jemandem erzählt.
Das Ideal, etwas objektiv mitzuteilen, so „wie es wirklich war“, wird zumindest annähernd erreicht, wenn zu einem und demselben Gegenstand mehrere Autoren, möglichst noch aus verschiedenen Ländern in ihrer (wenn man so will) „Subjektivität“ zu Wort kommen. Das, was dann Geschrieben steht, ergänzt und verstärkt sich und ganz wichtig, es hebt sich mitunter in manchem auch wieder auf.
Die Geschichtsschreibung muss durch möglichst viele Angebote „offen“ gehalten werden. Eine verordnete Staatsräson ist der Geschichtsforschung nicht dienlich.
Wie wohl kein anderer, ist es somit der Historiker, der die „offene Gesellschaft“ zur Voraussetzung haben muss.
Und schließlich so eigenartig es klingen mag: Der Historiker muss sich für die Aufnahme und Verbreitung seiner Erzählung Mehrheiten in der Öffentlichkeit verschaffen.
Sachsen und Preußen, die 1806 gemeinsam gegen Napoleon marschierten, gingen nach der erlittenen Niederlage bei Jena und Auerstedt getrennte Wege. Sachsen wurde durch den französischen Kaiser vereinnahmt und bestimmt.
Preußen blieb zu Frankreich auf Distanz.
Diskutiert wurde die mitunter illusionäre Neutralitäts- und die schwankende Bündnispolitik des sächsischen Hofes. Eine Flankierung der sächsischen Staatspolitik und der dazugehörigen Diplomatie durch das Militär, in anderen Staaten Grundlage der jeweiligen Stabilität, sollte in Sachsen nicht gelingen. Misserfolge waren unausweichlich.
Preußen gelang es, sich wieder aufzurichten, vor allem durch wirksame Reformen und eine gelungene Bündnispolitik. Das nach der Niederlage von 1806 reformierte preußische Militär und die Einbeziehung aller Bevölkerungskreise während der Befreiungskriege erwiesen sich als förderlich.
Mitunter wurde ein Vergleich zwischen dem Sachsen Thielmann und dem Preußen Yorck versucht. Tatsächlich kamen dabei Seiten einer möglichen Vergleichbarkeit zum Vorschein, die aber wiederum Elemente der Unvergleichbarkeit beider Persönlichkeiten zu Tage treten ließen.
Vergleichbar und zugleich unvergleichbar waren weiter die beiden Höfe, der in Sachsen und der in Preußen, sowie auch das Erscheinungsbild, welches die Untertanen beider Königreiche bei der Überwindung der französischen Fremdherrschaft lieferten.
Zurückgeblickt wurde auf das Sachsen, das sich hinsichtlich der Vormachtstellung in Mitteleuropa bereits über hundert Jahre in einen Wettstreit mit Preußen befand und 1815 scheiterte. Und dennoch! Das „Rest-Sachsen“, etwa in den Grenzen des ehemaligen albertinischen Territoriums, erwies sich als ein prosperierender Staat und zwar bis in die Gegenwart.
Eine Anmerkung zum Verhältnis von Sachsen zu Napoleon: Ein solches, wenn man sich unter „Verhältnis“ etwas Ausgewogenes vorstellt, gab es eigentlich nicht. Der sächsische König Friedrich August I. konnte mit seiner Außenpolitik, die sprichwörtliche „sächsische Neutralität“, nicht behaupten oder sie gar durchsetzen.
Trotz Niederlagen, Demütigungen sowie Verlust und Leiden im bürgerschaftlich-zivilen Leben gab es nirgendwo eine treuere Anhänglichkeit dem Herrscherhaus gegenüber, als es bei den sächsischen Untertanen zu verzeichnen war.
2. Festung und Feldschlacht – neue Erkenntnisse
In den Podiumsgesprächen sind die Festungen an der Mittleren Elbe in ihrer Funktion zu den Feldschlachten in Sachsen (1813) angesprochen worden; sowohl die Festungen im Einzelnen als auch die Festungen im Verbund.
Folgende Aussagen wurden getroffen: Napoleon hatte die Elbbefestigungen zu Kampagne-Festungen in Verbindung mit dem Konzept „doppelter Brückenkopf“ so umfunktioniert, dass dabei eine hohe Beweglichkeit seiner Truppen zustande kam und zwar gleich dreifach: erstens bei den Elbüberquerungen selbst, zweitens beim Nachsetzen von über den Strom gegangener feindlicher Militäreinheiten und drittens beim beschleunigten Aufmarschieren der eigenen Armeen in die jeweilige Feldschlacht.
Befestigungen, so Napoleon, seien als vorübergehende Bauten anzulegen und zwar die Offensive der eigenen Feldtruppen unmittelbar unterstützend.
Selbst der Preuße Helmuth von Moltke nutzte in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts noch die Erkenntnisse und Erfahrungen Napoleons hinsichtlich gedeckter, wechselseitiger Flussüberquerungen („doppelter Brückenkopf“) und der daraus resultierenden hohen Mobilität und Offensivkraft der Truppe.
3. Speziell zur Festung Torgau
Erstmals konnte eine Bestimmung der sächsischen Festung Torgau hinsichtlich ihres Standortes, ihrer Struktur und ihrer Funktion von 1806 bis 1815 vorgenommen werden. Außerdem ist ein Wissenszuwachs über die Rolle der Festung Torgau unter dem Kommandanten Thielmann in jener hoch sensiblen Zeit erzielt worden: Sachsen und seine Bündnisalternativen in der Zeit von Februar bis Mai 1813.
Torgau wurde von den sächsischen Ing.-Offizieren (Aster; Le Coq) gemäß des Anliegens, hier die Elb- und Landesfestung Sachsens zu errichten, großflächig und komplex in der Gestalt, als eine, auch in Friedenszeiten dauerhaft zu betreibende, defensive Befestigung konzipiert. Der dann aber alles bestimmende Befehl Napoleons zielte auf das genaue Gegenteil: Torgau musste zu einer offensiven und baulich „ausgedünnten“ wie flächenmäßig eingeengten („Kampagne-„) Festung gebaut werden.
Aufgrund der in der Stadt Torgau 1813 ausgebrochenen Typhus-Epidemie mit beinahe 30.000 Toten war die Festung weder als „offensive“ Fortifikation zur Unterstützung der Kampagne der napoleonischen Feldtruppen noch als ausgedehnte, komplexe und defensiv angelegte, d.h. Truppen, Verwundete und Seuchen-Kranke aufnehmende Landesfestung verwendbar.
Die Festung Torgau konnte nach dem grundsätzlichen Eingriff Napoleons weder die eine noch die andere Funktion erfüllen.
4. Bemerkungen zur „Torgau-Geschichte“
Das sächsische Torgau war nach 1815 preußisch geworden. Mit der Wende, 1990, kehrte per demokratischer Abstimmung die Stadt in den sächsischen Staatsverband zurück (dafür waren über 90% der wahlberechtigten Bürger).
Angemerkt werden muss aber, dass die Geschichtsschreibung über Torgau nach dem Wiener Kongress, aus dem sächsischen Torgau war ja ein preußisches geworden, zwei Jahrhunderte lang, sowohl durch die Preußen als auch durch die Sachsen, vernachlässigt worden war. Für Torgau fühlte sich kein Historiker mehr so richtig zuständig.
So ist es heute besonders begrüßenswert, dass die durchgeführten Tagungen sowie der vorliegende Sammelband „Sachsen, Preußen und Napoleon“ bisherige Versäumnisse und Auslassungen in der Torgauer Militär- und Festungsgeschichte mit beseitigen hilft.
Dass mit der Behandlung der Napoleonzeit die Wiederaufnahme der Geschichtsschreibung über Torgau durch die Tagungen auf Schloß Hartenfels sowie durch den Sammelband mit unterstützend vollzogen wurde, hängt auch mit der Organisation des Projektes zusammen.
So haben wir als Förderverein Europa Begegnungen e.V. eben nicht von anderen Institutionen, etwa von Universitäten und Akademien, die durchgeführte Tagungen importiert, d.h. Tagungen als „Fertigprodukt“ in den Tagungsort Torgau uns hinein legen lassen, wie es in der Stadt normalerweise praktiziert wird. Wir selbst waren es, die die Konzeption und die dafür unterlegte Theorie und Methode erarbeiteten und das Konzept europaweit versandten. Zuspruch und Unterstützung von Außen gab es zuhauf. Es meldeten sich Fachvertreter ersten Ranges, die auf der Grundlage des von uns erstellten „Kursbuches“ in den „Tagungszug“ einstiegen und hier in Torgau vorgetragen haben.
5. Napoleon und Europa
Wie zeigte sich das Europa mit seinen Einzelstaaten während der Napoleonzeit?
Durch die Eroberungen Napoleons in Europa und der anschließenden französischen Verwaltung der besetzten Gebiete hatte sich so etwas wie ein europäisches „Napoleon-Imperium“ herausgebildet. Dieses „europäisch-napoleonische Besatzungsgebiet“ zeigte sich besonders nach 1812 als deutlich instabil, und musste von Anfang an durch eine strenge französische Fremdherrschaft zusammen gehalten werden.
Es trat die Frage auf, ob eigentlich in dem besagten frankophilen Europa noch etwas für die heutige Situation der europäischen Staaten Förderliche abgewonnen werden könne?
Die Frage wurde kontrovers beantwortet.
Fazit: Ob sich da etwas Ableitbares ergibt, etwas, was sich sogar für das heutige Europa als tauglich erweist, sollte den in dieser Richtung in Versuchung Gekommenen überantwortet werden.
Wer da, mit welchem „Europablick“ auch immer, lange genug in die historischen Zusammenhänge hineinschaut oder gar zu suchen beginnt, der wird auch Ableitbares oder Analoges zu dem derzeitigen Europa finden.
Der Nachteil ist nur, wer hierbei die „Optik überdreht“, der wird viele andere Erzähl-Ebenen der Geschichte, möglicherweise die interessanteren, gar nicht wahrnehmen können.
Wer meint, er habe aus der Geschichte Ableitbares für das Heute gefunden, sollte, um glaubwürdig zu bleiben, in dem gleichen Zusammenhang auch über Nicht-Ableitbares sprechen.
Es bleibt wohl weiter zweifelhaft, ob überhaupt und wenn doch, mit welchem Nutzen die Menschheit aus der Geschichte lernen kann.
6. Die Autoren des Buches und über das Schreiben von Geschichte
Die Autoren des Buches gehören zum einen der Gilde der Fachhistoriker an, die an den Universitäten und Forschungsinstituten tätig sind oder waren. Zum anderen sind es Enthusiasten der Heimatgeschichte gewesen, welche sich autodidaktisch Kenntnisse über die zu behandelnden Gegenstände, über die Vergangenheit ihrer Städte und Regionen erarbeiteten. Es sind weiter Spezialisten der Festungsforschung und Militärgeschichte zu nennen, die alle untereinander einen Zugang zum jeweils anderen fanden.
Ein heute mitunter beklagtes Auseinanderdriften von Geschichtswissenschaft und interessierter Öffentlichkeit konnte während der Torgau-Tagungen zu keinem Zeitpunkt beobachtet werden. Es gab keine Kluft zwischen den Historikern und der Bürgerschaft.
Alle in das Torgauer Buch-Projekt einbezogenen Referenten und Autoren waren sich darin einig, die Geschichtsschreibung im traditionellen Sinne, d.h. historiografisch vorzunehmen. Geschichte wird erzählt. Denn das, was verstanden werden will, muss erzählbar sein.
7. Die Geschichtsschreibung ist „offen“ zu halten, mit anderen Worten „Geschichte ist ein Menschenrecht!“
Folgendes war den Gesprächen zu entnehmen:
Für den heutigen Menschen gibt es nichts Interessanteres, als zu erfahren, wie historische Personen lebten.
Weiter ist erkannt worden, dass Personen und Gruppen in der Geschichte nicht gesetzmäßig, ausschließlich materiellen Interessen gemäß vorgehen; somit ist eine gesetzmäßige Vorausbestimmbarkeit menschlichen Handelns nicht gegeben.
Es gibt an Einflussfaktoren gar viele.
Primär handeln historische Personen aus Angst, Liebe, Hass, Eitelkeit, Machtbedürfnis, Ruhmsucht. Sie agieren meist widersprüchlich, zufällig, irrational.
Die Nähe am „Wie es wirklich war“, d.h. das Streben nach Objektivität ist die natürliche Grundlage des entworfenen Geschichtsbildes und somit Kriterium für die Wahrhaftigkeit der erzählten Geschichte.
Dennoch: Alles Erzählte ist von Jemandem erzählt.
Das Ideal, etwas objektiv mitzuteilen, so „wie es wirklich war“, wird zumindest annähernd erreicht, wenn zu einem und demselben Gegenstand mehrere Autoren, möglichst noch aus verschiedenen Ländern in ihrer (wenn man so will) „Subjektivität“ zu Wort kommen. Das, was dann Geschrieben steht, ergänzt und verstärkt sich und ganz wichtig, es hebt sich mitunter in manchem auch wieder auf.
Die Geschichtsschreibung muss durch möglichst viele Angebote „offen“ gehalten werden. Eine verordnete Staatsräson ist der Geschichtsforschung nicht dienlich.
Wie wohl kein anderer, ist es somit der Historiker, der die „offene Gesellschaft“ zur Voraussetzung haben muss.
Und schließlich so eigenartig es klingen mag: Der Historiker muss sich für die Aufnahme und Verbreitung seiner Erzählung Mehrheiten in der Öffentlichkeit verschaffen.
Die Berichterstattung von Torgau-TV finden Sie hier:
Tagung der Festungsforscher und Historiker am 11. und 12. Oktober 2013 auf Schloss Hartenfels in Torgau