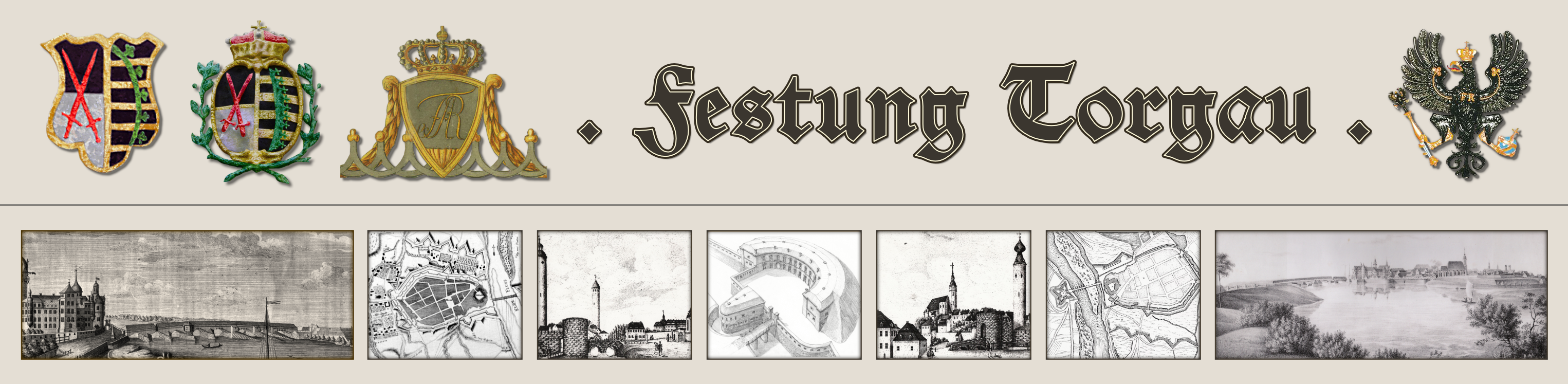
Tagung der Historiker und Festungsforscher
Torgau/Elbe, 12. und 13. Oktober 2012
Nach dem Russlandfeldzug. Erhebungen gegen Napoleon I.
Ort: Schloss Hartenfels, Plenarsaal, Flügel D (Innenhof), 2. Etage
R e s ü m e e
Die 14. Tagung begann mit einer Führung von Gernot Klatte durch die Sonderausstellung "Churfürstliche Guardie" im Schloß Hartenfels in Torgau. Gezeigt wurden (vorrangig) Exponate der Bewaffnung und Ausstattung Kursächsischer Leibgarden. Herr Klatte ist Mitarbeiter der Rüstkammer der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden.
In die Tagungsmappe wurden neben der Adressenliste und dem Wissenschafts- bzw. Tätigkeitsprofil der angemeldeten Personen (Teilnehmerzahl insgesamt 141) folgende Stücke eingefügt:
- Flyer der Ausstellungen "Neidhardt von Gneisenau", Museum Schildau (bei Torgau) und "Das Vaterland ist frey", Oberschlesisches Landesmuseum Ratingen.
- "Grundsteinlegung zum Denkmal für Friedrich den Großen", in: Torgauer Kreisblatt, Freitag, den 4. November 1910
- "Enthüllung des Denkmals Friedrich des Großen", in: Torgauer Kreisblatt, Sonnabend, den 19. Oktober 1912 (Kopie-Vorlagen von Dr. Landschreiber)
Im Tagungssaal (Flügel D) befand sich der Büchertisch, der durch den Veranstalter und die Teilnehmer mit aktueller Literatur (Bücher; Zeitschriften; DVDs) ausgestattet worden war. Darüber hinaus findet der Interessierte auf den Webseiten des Veranstalters die Festung Torgau vorgestellt.
- Im Tagungssaal waren weiter die Posterstände untergebracht, die zu folgenden Themen die Aufmerksamkeit der Teilnehmer erlangten:
- Friedrich der Große und Torgau – in Zeitungsartikeln besprochen und auf Ansichtskarten festgehalten (Dr. K. Landschreiber)
- Neidhardt von Gneisenau und die Stadt Schildau, Ausstellungsstand des Schildbürger-Museums Schildau (W. Cernik) sowie Gneisenau-Gedenkstätte Sommerschenburg (Dr. F. Bauer)
- Erinnerungen an die Befreiungskriege (D. Arlt)
- Über einige Maßnahmen gegen die napoleonische Bedrohung von Berlin und Brandenburg im Jahr 1813 (Prof. H.-J. Paech)
- Flankenkasematten der preußischen Festung Torgau (N. Lange)
- Statik der Jahrhunderthalle in Breslau (N. Lange)
- Auslagen zur Militär- und Festungsgeschichte (Dr. M. Klöffler)
Eine Ausstellung von Aquarellen zum Thema "Natur und Festung" wurde eröffnet. Ziel dieser Exposition war, das Thema Festung Torgau über den Weg der Kunst den Menschen näher zu bringen. 60 Aquarelle der Torgauer "Malgruppe 725", Ltg. Sieglinde Lawrenz, konnten betrachtet werden.
Die Exkursion zum Abschluss der Tagung führte die Teilnehmer zur noch erhaltenen rechten Flankenkasematte (Defensionskasematte mit Unterbringungsteil für die Mannschaft) der Bastion VII der (preußischen) Festung Torgau. Es handelt sich hierbei um eine Kasematte von insgesamt 14 solcher Bauten mit meistens fünf Tonnengewölben; a 18 m lang, 4,5 m breit, 3 m hoch; a Tonne 30 Soldaten; Bauzeit 1820-1830.
Bei der Gelegenheit wurden die jüngst restaurierten Schlusssteine aus Rundbögen der sächsischen sowie der preußischen Festung Torgau erläutert: FAR 1811(2x), FWR III. 1819 (2x), FWR III. 1820 und ein Stein von 1871.
Die Stücke entstammen solchen geschleiften Festungsbauten wie Poternen, evtl. auch Festungstoren und der revettierten Eskarpe sowie (ev.) eines Geschossladesystems.
Die Exkursion wurde vorbereitet und getragen durch Mitglieder des Sachsen-Preußen-Kollegiums des Förderverein Europa Begegnungen e.V. wie Herr D. Dudek, Herr N. Lange, Dr. K. Landschreiber, Herr A. Rohr u. a.
Zusammenfassungen der Vorträge zur Tagung:
Prof. Dr. Thomas Stamm-Kuhlmann (Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern)
Preußen und Rußland. Tauroggen und die Strategieüberlegungen der preußischen Regierung vom November 1812 bis zum Abschluss des Bündnisses von Kalisch.
Während Napoleon den Rückzug aus Moskau antrat, war Preußen noch mit Frankreich verbündet. Die Nachricht von der Schwächung der napoleonischen Armee löste in Berlin Überlegungen aus, wie man die Handlungsfähigkeit als europäische Großmacht mit dem Status von 1806 wiedergewinnen könne. Auf eigene Faust vollzog General Yorck in Tauroggen die Neutralisierung seines Korps, die für ihn nur ein Schritt zur Wendung gegen Frankreich sein konnte. König Friedrich Wilhelm III. ließ sich dagegen von einer wachsenden Stimmung in der preußischen Bevölkerung zu dem Entschluss treiben, am 26. Februar 1813 mit dem Kaiser von Russland ein Offensiv- und Defensivbündnis zu schließen.
Dr. Frank Wernitz (München, Freistaat Bayern)
Die Ausgestaltung einer königlichen Idee – Vom eisernen Ordenskreuz zum vollendeten Bildwerk Eisernes Kreuz. Eine Hommage an Ferdinand Graf von Einsiedel.
Von Lauchhammer ausgehend erfuhr Ende des 18. Jahrhunderts der Eisenbildguss eine technische Blüte, wobei die Vision des Grafen Detlev Carl von Einsiedel, mit künstlerischem Verstand und technischer Sorgfalt Kunstwerke in Eisen ausführen zu lassen, grenzüberschreitend auf breite Anerkennung stieß. So begann ein gutes Jahrzehnt später auch Gleiwitz sich dem Eisenkunstguss zuzuwenden, wobei mannigfaltige wechselseitige Geschäftsverbindungen zwischen der schlesischen Hütte und Lauchhammer nachweisbar sind. Die freundschaftlichen Beziehungen zwischen Graf Detlev Carl von Einsiedel und dem preußischen Minister von Heynitz waren dabei nicht nur für die Entwicklung des Gleiwitzer Kunstgusses förderlich, sondern fanden auch Niederschlag in personellen Angelegenheiten. Neben dem Austausch von Formern und Gießern stellt die Berufung Ferdinands zum Nachfolger Graf Redens als Leiter des Oberbergamtes Breslau, später Brieg und Berghauptmanns von Schlesien einen Höhepunkt dar. Dessen Einbindung in den Gestaltungsprozess für ein in Eisen gegossenes Ehrenzeichen als Auszeichnung im Kampf um Preußens Freiheit und Selbstständigkeit – dem späteren Eisernen Kreuz – durch Friedrich Wilhelm III. war einerseits ein deutliches Signal der persönlichen Wertschätzung, möglicherweise aber auch eine Geste der königlichen Hochachtung vor den technischen wie künstlerischen Fertigkeiten der Lauchhammer Gießerei.
Dr. Josef Ulfkotte (Dorsten, Nordrhein-Westfalen)
Widerstand gegen Napoleon: Der Ordensbruder Friedrich Ludwig Jahn und sein patriotisches Umfeld
Am 17. März 1813 rief der preußische König Friedrich Wilhelm III. "sein Volk" zum Widerstand gegen die napoleonische Fremdherrschaft auf. Sein Appell blieb in der Bevölkerung, insbesondere im gebildeten Bürgertum und in der akademischen Jugend nicht ungehört, zumal gezielte Aktivitäten patriotischer Kreise nach der desaströsen Niederlage der preußischen Truppen in der Schlacht bei Jena und Auerstedt (1806) dafür den Boden bereitet hatten. Neben Ernst Moritz Arndt zählte Friedrich Ludwig Jahn in diesen Jahren zu den wirkungsmächtigsten Propagatoren des antifranzösischen Widerstandes. Dabei konnte er auf frühere Mitglieder des geheimen studentischen Ordens der Unitisten zurückgreifen, dem er 1798 in Halle beigetreten war. In Lübeck erschien 1810 sein unter den Bedingungen der französischen Besatzung entstandenes Hauptwerk "Deutsches Volksthum", im Herbst des Jahres gründete er in Berlin gemeinsam mit Karl Friedrich Friesen den geheimen "Deutschen Bund". Mit Friesen entwarf Jahn 1811/12 die "Burschenordnung", die bei der Gründung der Jenaer Burschenschaft Pate stand. Um die männliche Jugend auf den Kampf gegen die napoleonische Unterdrückung vorzubereiten, eröffnete er im Juni 1811 auf der bei Berlin gelegenen Hasenheide den ersten öffentlichen Turnplatz, der in den nächsten Jahren zahlreiche Turnplatzgründungen – vornehmlich in Norddeutschland – nach sich zog. Mit den älteren Turnern der Hasenheide schloss er sich 1813 dem Lützowschen Freikorps an.
Dr. Roland Müller (Dresden, Freistaat Sachsen)
Breslau im Jahrhundertjahr
Die Ausstellung, die Feiern der Freiheitskriege von 1813 und die Jahrhunderthalle als Ort und Denkmal für das Jahrhundertereignis
Der Referent schilderte wie lebendig in Breslau im Jahr 1913 die Erinnerung an die Volkserhebung von 1813 noch war. Der Bogen wurde dabei geschlagen vom Bau der Jahrhunderthalle, ihrem Bauherrn und dem Architekten, über die Feierlichkeiten zu ihrer Eröffnung mit dem eigens dazu geschaffenen Festspiel von Gerhart Hauptmann bis zur historischen Ausstellung. Mit der Skizzierung der zahlreichen weiteren sehr unterschiedlichen Veranstaltungen aus Anlass des Jubiläums wird erkennbar, wie groß die Ausstrahlung der Jahrhundertfeier von 1913 über Breslau hinaus war. Analysiert wurde dabei auch, wie es dazu kam, dass im Volk, d.h. in großen Teilen des Bürgertums und in der Arbeiterschaft, überwiegend eine andere Sicht auf das Jahrhundertereignis bestand als im preußischen Königshaus, im schlesischen Adel und in einer kleineren Gruppe des Bürgertums, die sich zur Herrschaftselite zählte. Dazu wurden die Ereignisse des Jahres 1813 in Breslau und deren Vorgeschichte in Erinnerung gerufen. Im Zusammenhang mit der Absetzung des Festspieles, die zu einem weit beachteten Eklat führte, wird die zwiespältige Sicht auf die historischen Ereignisse 1813 nochmals sichtbar. Zugleich wurden anhand der Akten des Breslauer Magistrats Hintergründe der Jahrhundertfeier und Episoden aus ihrem Verlauf geschildert, die heute vielfach in Vergessenheit geraten sind.
Dr. Thomas Lindner (Bad Honnef, Nordrhein-Westfalen)
Gneisenau und die preußischen Militärreformen
August Neidhardt von Gneisenau war neben Gerhard von Scharnhorst der führende Kopf der preußischen Militärreformen zwischen 1807 und 1813. Nach dem frühen Tod Scharnhorsts in Folge einer bei Großgörschen 1813 erlittenen Verwundung wurde er als Blüchers Generalstabschef zum Kopf des erfolgreichen Feldzugs zur Befreiung Deutschlands von der Napoleonischen Herrschaft, der im Juni 1815 auf dem Schlachtfeld von Belle Alliance / Waterloo sein Ende fand. Der Vortrag lieferte ein Lebensbild Gneisenaus, der 1760 im sächsischen Schildau (bei Torgau) geboren wurde, vornehmlich anhand eigener und fremder Zeugnisse aus den zeitgenössischen Quellen. Auf diese Weise entsteht ein umfassendes und manchmal überraschendes Portrait des Mannes, der kongenial zu Scharnhorst, aber dennoch auf eine ganz eigene und leidenschaftliche Art, die preußischen Militärreformen in den allgemeinen Prozess der Staats- und Bildungsreformen Steins, Hardenbergs und Humbolts einzuordnen wusste.
Dr. Martin Klöffler (Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen)
Die Elbe verteidigen – Feldbefestigungen im Herbst 1813
Der Vortrag analysierte den Einfluß der Feldbefestigungen entlang der Elbe auf die Verteidigungsstrategie der Franzosen und die Angriffsstrategie der Alliierten im September – Oktober 1813 aus der klassischen Sicht eines Generalstäblers. Ein Fluß kann immer nur als ein Hindernis angesehen werden, welches den Feind höchstens einige Tage aufhält. Die Bautechnik wurde im Vortrag aus taktisch-ingenieurtechnischer Perspektive vorgestellt und die realisierten Feldbefestigungen wurden an Hand von Beispielen erläutert. Ein ganzes Befestigungssystem, wie die Elblinie, hat keinen Eigenwert, sondern gewinnt seine Geltung nur in Zusammenhang mit Operationen der Feldarmee.
Prof. Dr. Rudolf Jenak (Dresden, Freistaat Sachsen)
Das Königreich Sachsen in der Kampagne von 1813 Dokumente des sächsischen Kabinetts
Der Vortrag widmete sich politischen Dokumenten, die von der königlich-sächsischen Regierung im Hinblick auf den bevorstehenden bzw. bereits im Gange befindlichen Krieg Frankreichs und des Rheinbundes gegen Rußland im Jahre 1812 beschlossen wurden. Ausführlich wurde ein Text des Historikers und Hofrats Carl August Böttiger kommentiert, der die moralische Notwendigkeit begründete, an der Seite des großen Kaisers Napoleon gewaltsam gegen das reaktionäre brutale und äußerst rückständige Regime Russlands vorzugehen. Ein ebenfalls im Frühjahr 1812 fertig gestelltes statistisches Werk des Geheimen Kabinetts über die territoriale, agrarische und sozial-ökonomische Beschaffenheit der westlichen Gouvernements Russlands sollte Aufschluss geben, mit welchen Gegebenheiten die sächsischen Behörden es bei der Wiederherstellung des Königreichs Polen im erhofften Ergebnis dieses Krieges zu tun haben würden. Die Instruktion des sächsischen Kabinettsministers, des Grafen von Senfft-Pilsach, für den nach Wilna, in das Hauptquartier des Kaisers Napoleon, entsandten Vertreter des sächsischen Königs, des Generalmajors von Watzdorf, verdeutlichte die aktuelle Interessenlage des sächsischen Hofes im Zuge dieser Kampagne. Die Dokumente über die Verfolgung des antifranzösischen Tugendbundes, speziell seines vermeintlichen prominenten Vertreters, des flüchtigen ehemaligen preußischen Polizeidirektors Julius Gruner, sowie die Vorgänge um die beiderseits erwünschte Beilegung des Enklaven-Problems entlang de preußisch-sächsischen Grenze, die das entspannte Verhältnis beider Staaten seit Abschluss des französische-preußischen Allianz-Vertrages vom Februar des Jahres charakterisierten, rundeten die beabsichtigte Darstellung diese Aspektes des Jahres 1812 ab.
Prof. Dr. Reiner Groß (Kreischa OT Lungkwitz, Freistaat Sachsen)
Banner der freiwilligen Sachsen
Das Kurfürstentum Sachsen in den Grenzen vom Sommer 1806 war nach der militärischen Niederlage an der Seite Preußens bei Jena von Napoleon mit dem Vertrag von Posen im Dezember 1806 in den Rheinbund gezwungen worden. Danach blieb das zum Königreich erhobene Sachsen unter König Friedrich August I. bis zur Niederlage Frankreichs in der Völkerschlacht bei Leipzig im Oktober 1813 der Bündnispartner Frankreichs. In diesen sieben Jahren von 1806 bis 1813 gab es in Sachsen keine Erhebung gegen die napoleonische Herrschaft, obwohl es zunehmend eine Opposition in Sachsen gab. Es waren einflussreiche sächsische Adelige und leitende Staatsbeamte, die sich um Dietrich von Miltitz auf Siebeneichen zusammengefunden hatten. Dieser Siebeneichener Kreis versuchte seit 1809, eine Loslösung von Frankreich zu erreichen. Dies scheiterte aber nicht nur an König Friedrich August I. und seinen Ratgebern, sondern nach dem Rußlandfeldzug 1812 auch an den territorialpolitischen Zielen Preußens und Rußlands, trotz guter persönlicher Verbindungen der Reformer zu Reichsfreiherr Stein und Zar Alexander I. Erst nach dem Oktober 1813 konnten Miltitz und Carlowitz unter dem Generalgouvernement ihre Pläne für eine Volksbewaffnung verwirklichen. Die Bildung des "Banner der freiwilligen Sachsen" war der Höhepunkt dieser Bestrebungen. Trotzdem konnten die Angehörigen des Siebeneichener Kreises die Teilung des Königreiches Sachsen mit dem Vertrag von Preßburg vom 18. Mai 1815 nicht verhindern.
Dr. Gerhard Müller (Jena, Freistaat Thüringen)
Die wettinischen Staaten in napoleonischer Zeit
Der Beitrag strebte einen Überblick über die Situation und Entwicklung der sächsischen Staatenwelt in den Jahren der napoleonischen Hegemonie zwischen der Schlacht bei Jena und Auerstedt 1806 und der Leipziger Völkerschlacht 1813 an und hat diesen aber vornehmlich aus der Perspektive eines dieser Staaten, des Herzogtums Sachsen-Weimar-Eisenach, vorgenommen.
Zunächst wurde die politische Stellung der sächsischen Staaten im Rheinbund, die ihnen zugedachte Funktion in der politischen Architektur des französischen Hegemonialsystems und die sich daraus ergebenden Handlungs- und Entwicklungsspielräume betrachtet. Dabei wurde gezeigt, dass die sächsischen Staaten anders als die Rheinbundstaaten im Süden und Westen Deutschlands nicht nur weitestgehend in ihrer aus dem alten Reich überkommenen Territorial- und Verfassungsstruktur verblieben, sondern dass die französische Hegemonialmacht sich hier auch bewusst auf die Herrschaftstradition der Wettiner stützte und die sächsischen Staaten ungeachtet des in der Rheinbundakte proklamierten Souveränitätsprinzips als einen dynastischen Territorialverbund unter der Suprematie der zur Königswürde erhobenen albertinischen Linie in Dresden betrachtete. Die damit gegenüber dem traditionellen Gegenspieler Brandenburg-Preußen deutlich aufgewertete politische Position der Wettiner korrespondierte mit einer im Vergleich zu anderen Rheinbundstaaten weitaus größeren Autonomie im Innern sowie einer durch die Personalunion der sächsischen Königswürde mit dem Großherzogtum Warschau, die an die politischen Ambitionen Augusts des Starken anknüpfte, noch verstärkten kulturellen Brückenfunktion zwischen Ost- und Westeuropa. Ob und wie die sich aus dieser Ausgangslage ergebenden Chancen genutzt werden konnten, wurde abschließend exemplarisch anhand der Politik Sachsen-Weimar-Eisenachs erörtert.
Inhalte der Podiumsdiskussionen nach den beiden Vortragsblöcken:
Sachsen und Preußen – teleologische Geschichtsschreibung?
Dr. U. Niedersen
Von dem Historiker Treitschke wird gesagt, dass er in dem geschichtlichen Werdegang Preußens keinen Sinn fand. Das wollte er nicht so auf sich beruhen lassen und erfand für das preußische Tun einen Sinn: eine Berufung zur Macht, etwa die deutsche Einheit herzustellen.
Eine solche teleologische Geschichtsschreibung hat den großen Nachteil, dass die Antwort schon in der Fragestellung bzw. durch das vorab zugrunde gelegte Motto mitgeliefert wird. Bei dieser Art Geschichtsschreibung büßt die Zukunft ihre Offenheit ein. Folglich hat diese Methode mit Wissenschaft wenig gemein.
Um so mehr hat es mich verwundert, dass ein bekannter sächsischer Historiker vor nicht allzu langer Zeit einen Aufsatz zum Thema “Sachsens geschichtlicher Auftrag“ abfasste. Hierin vermerkt er: Die Selbstbeschränkung und der friedlichen Grundhaltung Kursachsens stand der preußische Wille zur Macht mit der logischen Folge der Expansion bei jeder sich bietenden Gelegenheit gegenüber.
Das ist hier so wie bei Treitschke, eben nur von der anderen Seite her sich dem Gegenstand nähernd.
Aber, Geschichtsschreibung ist nun einmal erzählend. Sie teilt der Öffentlichkeit mit, wie es war. Einen Sinn oder gar Gesetze in der Geschichte fest zu machen, funktionierte vor der Wende „in unseren Breiten“ auch schon nicht.
Prof. Dr. R. Groß
Ausgehend von der Auffassung eines sächsischen Landeshistorikers, die von Dr. Niedersen einleitend angesprochen wurde, dass der geschichtliche Auftrag Sachsens in umfassenden Leistungen in Wirtschaft, Kultur und Wissenschaft im Gegensatz zur politisch-militärisch ausgerichteten Entwicklung Preußens stehe, wurde über diese These als einem ersten Schwerpunkt in Bezug auf das Kolloquiumsthema diskutiert. Es wurde darauf hingewiesen, dass die Markgrafen von Meißen, die späteren Kurfürsten und Könige von Sachsen ebenso wie die Markgrafen und Kurfürsten von Brandenburg und späteren Könige von Preußen bestrebt waren, ihren territorialen Herrschaftsbereich zu erweitern. In diesem Bestreben waren die Wettiner spätestens nach 1763 weniger erfolgreich als die Hohenzollern. Letztlich sollte man nicht von einem Auftrag in der geschichtlichen Entwicklung in retrospektiver Betrachtung sprechen, da es immer um das Bemühen des Historikers zu gehen habe, einen objektiv abgelaufenen Prozess zu erfassen.
Prof. Dr. R. Jenak
Die Rivalität zwischen Kursachsen und Kurbrandenburg zeigte sich deutlich darin, dass nach dem Erwerb der polnischen Krone durch Kurfürst Friedrich August I. im Jahre 1697 der Kurfürst von Brandenburg, Friedrich III., sich in Königsberg krönen ließ, den Titel Friedrich I., König in Preußen annahm.
Während der Herrschaft des Sohnes dieses Königs, Friedrich Wilhelm I., gab es neben Begegnungen und Gemeinsamkeiten auch wiederholt Differenzen um territoriale Fragen, z. B. in Danzig und Elbing, die allerdings durch Unterhandlungen beigelegt werden konnten.
Es wäre nicht korrekt, zu behaupten, nur die preußische Seite sei darauf erpicht gewesen, ihren politischen und ökonomischen Einfluss zu erweitern. Im ersten Schlesischen Krieg, den König Friedrich II. 1740 gegen Österreich vom Zaune brach, fand er die wohlwollende Unterstützung durch Kursachsen, das dabei die Hoffnung hegte, in seinem Streben nach einer Landbrücke von Sachsen nach Polen begünstigt zu werden. Die Rivalität Preußens gegenüber Sachsen bestand aber gerade darin, dass Friedrich II. gar nicht daran dachte, einen solchen Vorteil zu gewähren.
Dr. G. Müller
Ich plädiere gegen die Konstruktion eines teleologischen Geschichtsbildes, das Sachsen (oder auch Preußen) eine irgendwie vorbestimmte historische Aufgabe zuweist, wie das z. B. Treitschke bezüglich Preußens Bedeutung für die Einheit und Staatlichkeit der Deutschen getan hat. Ein solches teleologisches Geschichtsbild würde die Annahme voraussetzen, dass es Persönlichkeiten (oder Gruppen von Menschen) gibt, denen eine solche Zielstellung bereits Jahrzehnte oder Jahrhunderte, bevor sie auf der historischen Tagesordnung steht, geistig präsent ist und von ihnen verfolgt wird. Überlegungen dieser Art führen in einen mystischen Bereich, da sie gleichsam die Annahme übermenschlicher Wissensinhalte und Erkenntnisfähigkeiten implizieren, die es schlechthin nicht gibt. Preußens historische Rolle war nicht vorherbestimmt, und es gab immer wieder Situationen, in denen es auch ganz anders hätte kommen können und nur historische Zufälle (wie z. B. der Tod der russischen Zarin Elisabeth und die Machtübernahme der preußenfreundlichen Zarin Katharina II. im Siebenjährigen Krieg) dafür verantwortlich waren, dass Preußen nicht unterging und es so kam, wie wir es aus den Geschichtsbüchern kennen. Was es aber gibt, sind Traditionen, die von historischen Erfahrungen über Generationen hinweg durch die anhaltende Kontinuität analoger Interessenslagen (wie z. B. die geopolitische Mittellage Sachsens im Expansionsbereich Brandenburgs resp. Preußens und anderer benachbarter Mächte) immer wieder bestätigt und ausgeformt werden. So kann man etwa in Sachsen von einer Politik- und Verwaltungstradition sprechen, die darauf gerichtet war, die ökonomischen und kulturellen Ressourcen als Stabilitätsfaktor und Alternative zur Machtstaatspolitik zu entwickeln und zu nutzen, was nicht ausschloss, dass in bestimmten Situationen, wie wir etwa in dem Beitrag von Prof. Jenak zu 1812 hörten, auch Staatsmacht- und Expansionsambitionen zum Tragen kommen konnten.
Tradition und Wertebezug
Dr. Th. Lindner
August Neidhardt von Gneisenau war neben Gerhard von Scharnhorst der herausragende Protagonist der preußischen Heeresreformen in der Zeit zwischen 1807 und 1813. Als Generalstabschef der Schlesischen Armee an der Seite des Feldmarschalls Blücher hatte er zudem an der Befreiung Deutschlands von der Napoleonischen Herrschaft und dessen endgültiger militärischer Niederlage bei Waterloo/Belle Alliance im Juni 1815 maßgeblichen Anteil.
Neben dem eher bedachtsamen Scharnhorst und dem aristokratischen Minister vom Stein war Gneisenau ein glühender Idealist und Patriot, der die einzelnen Maßnahmen der preußischen Heeresreform mit Eifer und nimmermüder Energie verfocht. Bereits bei der erfolgreichen Verteidigung der Festung Kolberg hatte er unter Beweis gestellt, zu welchen Erfolgen mitreißende Menschenführung, Entschlossenheit und Führen durch Beispiel im Stande waren.
Zugleich haben mit dem heutigen Wissen Gneisenaus flammende Aufrufe und sein romantisches Pathos auch etwas Erschreckendes. Zudem gilt es zu bedenken, dass er in jeweils unterschiedlicher Interpretation traditionsbildend für die preußische Armee der Kaiserzeit, für die Wehrmacht, für die Nationale Volksarmee der DDR und heute auch für die Bundeswehr war bzw. ist. Dies bedarf zumindest der Erläuterung.
Gneisenaus Denkschriften, Briefe und Artikel lagen zeitlich weit vor dem Traditions- und Zivilisationsbruch des Zweiten Weltkriegs. Die verheerenden Erfahrungen eines rassenideologischen Vernichtungskrieges, eines unbeschränkten Partisanenkrieges und der auf ihn folgenden Repressionen waren noch nicht erlebt. Vor allem aber kennzeichnete ein klarer Wertebezug Gneisenaus Tätigkeit und seine publizistischen Aktivitäten: Freiheit, Menschenwürde, Rechtsstaatlichkeit und Selbstbestimmung des Individuums waren feste Größen seines Denkens und Handelns.
In diesem Wertebezug liegt vielleicht die engste Verbindung mit seinem Ururenkel, Oberst Claus Schenk Graf von Stauffenberg. So ist es nur folgerichtig, dass neben den eigenen Traditionen aus mehr als 50 Jahren Bundeswehr die preußischen Heeresreformen, der militärische Widerstand gegen Hitler und das NS-Regime die drei tragenden Säulen des Traditionsverständnisses unserer Streitkräfte in der Demokratie sind.
Dr. F. Wernitz
Das Bündnis mit Preußen und die Gestellung eines preußischen Hilfskorps hatte in den Planungen Napoleons stets nur eine untergeordnete Rolle gespielt. Vielmehr sollte das Land als Aufmarsch-, Versorgungs- und Rekrutierungsgebiet für die Grande Armée im Krieg gegen Russland dienen. Obwohl voller Verzweiflung über den politischen Kurs der Regierung rund 30 preußische Offiziere, darunter Gneisenau, Hermann von Boyen (1771–1848), Karl Wilhelm von Grolmann (1777–1843) und Karl von Clausewitz (1780–1831) ihren Dienst quittierten, gehorchte die Armee. Allerdings wirkten diese Patrioten auch im Ausland für eine Befreiung Preußens und Deutschlands vom napoleonischen Joch.
Dr. J. Ulfkotte
Aus heutiger Sicht betrachtet amüsieren wir uns vielleicht über einzelne Passagen in Jahns 1810 erschienenem Hauptwerk „Deutsches Volksthum“, andere lehnen wir zu recht wegen ihrer völkischen bzw. chauvinistischen Tendenzen ab. Aus der kritisch-distanzierten Sicht des Historikers ist dieses Werk dennoch eine wichtige Quelle zur deutschen Geschichte im Zeitalter Napoleons, weil sie den Blick freilegt auf die Bestrebungen und Vorstellungen einer kleinen Gruppe nationaldeutscher Patrioten um den Freiherrn v. Stein u.a., die nicht nur die Beseitigung der französischen Fremdherrschaft erstrebten, sondern auch die Gründung eines deutschen Nationalstaates. Verstehen und differenziert beurteilen lassen sich Jahns nationaldeutsche Aktivitäten nach dem Desaster von 1806/07 nur aus der Zeit selbst heraus. In der wechselvollen deutschen Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts sind je nach politischer und gesellschaftlicher Interessenlage „Jahnbilder“ produziert worden, die sich bei genauerem Hinsehen als Zerrbilder erweisen und letztlich mehr über die Zeit aussagen, in der sie entstanden, als über Werk und Wirken Jahns selbst.
Prof. Dr. Th. Stamm-Kuhlmann
Heute hat das Gedenken an Friedrich Ludwig Jahn eine Form angenommen, bei der man Jahns Text „Deutsches Volkstum“ gerne übergeht, weil der Text im Jahre 2012 nicht als zeitgemäß empfunden wird.
Eine Tendenz in der Ausgestaltung des Gedenkens ist legitim, wenn diese Tendenz sichtbar gemacht wird und keine wesentlichen Geschichtstatsachen unterschlagen werden.
Die Forderung, man möge Personen wie Friedrich Ludwig Jahn oder Ernst Moritz Arndt „aus ihrer Zeit verstehen“, ist hingegen dann gerechtfertigt, wenn Maßstäbe drohen an diese Personen angelegt zu werden, die zu ihren Lebzeiten noch nicht zur Verfügung standen.
Hier befindet man sich allerdings wiederum oft im Irrtum. Es gibt bedeutende Zeitgenossen von Arndt und Jahn, die, wie Goethe, der Greifswalder Dichter Kosegarten oder Heinrich Heine, die sich den Franzosenhass nie zu eigen gemacht haben. Diese Tatsache deutet darauf hin, dass sich für Arndt und Jahn sehr wohl eine Alternative zu ihrer Haltung geboten hat.
Auch der Antisemitismus, der sich bei manchen deutschen Patrioten der Befreiungskriege und des Vormärz zeigte, war nicht ohne Alternative. Nicht alle Zeitgenossen waren Judenhasser oder wollten die Juden aus dem Volk ausschließen. Lessings „Nathan der Weise“ gehörte bereits zum Bestand der deutschen Literatur.
Breslau 1813, 100 Jahre danach
Prof. Dr. Th. Stamm-Kuhlmann
Das Beispiel der Jahrhundertfeier in Breslau 1913 zeigt, dass jedes Gedenken mit einer Absicht verbunden ist, die aus der jeweiligen Gegenwart stammt. Die liberalen Stadtväter von Breslau hatten 1913 die Absicht, dem konservativen preußischen Königshaus eine Botschaft zu übermitteln: Man möge aus den Ereignissen der deutschen Erhebung des Jahres 1813 die Schlussfolgerung ableiten, dass dem Volk mehr Vertrauen entgegen gebracht und die Politik daher demokratisiert werden könne. Dies gelte erst recht im Jahre 1913, wo man es an Treuebekundungen gegenüber dem Herrscherhaus nicht fehlen lassen werde.
Dr. R. Müller
Die Geschichte der Jahrhunderthalle in Breslau ist ein typisches Beispiel für die wechselvolle Geschichte in den Beziehungen zwischen Deutschland und Polen. Das Bauwerk, mit dem Breslau im deutschen Kaiserreich zu Beginn der zweiten Dekade des vergangenen Jahrhunderts auf sich aufmerksam gemacht hat, erlebte schon 1913 stürmische Tage. Gerhart Hauptmann hatte mit seinem zur Eröffnung der Halle geschriebenen „Festspiel in deutschen Reimen“ auch den gesellschaftlichen Fortschritt und die Sehnsucht nach Frieden gefeiert und damit den Unwillen der seinerzeit Herrschenden hervorgerufen. Nach Jahren als Lebensmittellager während des ersten Weltkrieges war das Bauwerk nach der Novemberrevolution 1918 der erste Versammlungsort der Breslauer Arbeiter, Soldaten und Bürger und wurde dabei von Max Berg als „Dom der Demokratie“ geweiht. Das Gegenteil davon, das Ende jeder demokratischen Kultur, verkündete Adolf Hitler 1933 in der Halle. Nach dem Zweiten Weltkrieg erlebte sie im nunmehr polnischen Breslau/Wroclaw eine neue Nutzung. Dass sie, inzwischen sehr sorgfältig saniert und restauriert, sowie seit 2006 auf der UNESCO-Weltkulturerbeliste stehend, in der Oderstadt eine große kulturelle Bedeutung besitzt, ist nicht zuletzt auch Ausdruck des Respekts gegenüber dem deutschen Bauherren, dem Magistrat der schlesischen Provinzhauptstadt und dessen Stadtbaurat Max Berg, der für dieses Bauwerk verantwortlich war. Die Weltoffenheit und Aufgeschlossenheit sehr vieler ihrer Einwohner gegenüber der deutschen Vergangenheit der Stadt wird an ihrem Beispiel sichtbar. Breslau mit dieser Halle, den darin stattfindenden Veranstaltungen und seinen Museen ist immer einen Besuch wert.
Weitere Tagungen
Mitteilung über Themen und Termine der folgenden wissenschaftlichen Tagungen in Torgau, Schloß Hartenfels:
24. und 25. Mai 2013 – Schlachten und Befestigungen. Die Situation vor der Völkerschlacht bei Leipzig.
11. und 12. Oktober 2013 – Länder, Festungen und Armeen, deren Siege und Kapitulationen. Wien: Das neue „Alte Europa“
Dr. Uwe Niedersen
In die Tagungsmappe wurden neben der Adressenliste und dem Wissenschafts- bzw. Tätigkeitsprofil der angemeldeten Personen (Teilnehmerzahl insgesamt 141) folgende Stücke eingefügt:
- Flyer der Ausstellungen "Neidhardt von Gneisenau", Museum Schildau (bei Torgau) und "Das Vaterland ist frey", Oberschlesisches Landesmuseum Ratingen.
- "Grundsteinlegung zum Denkmal für Friedrich den Großen", in: Torgauer Kreisblatt, Freitag, den 4. November 1910
- "Enthüllung des Denkmals Friedrich des Großen", in: Torgauer Kreisblatt, Sonnabend, den 19. Oktober 1912 (Kopie-Vorlagen von Dr. Landschreiber)
Im Tagungssaal (Flügel D) befand sich der Büchertisch, der durch den Veranstalter und die Teilnehmer mit aktueller Literatur (Bücher; Zeitschriften; DVDs) ausgestattet worden war. Darüber hinaus findet der Interessierte auf den Webseiten des Veranstalters die Festung Torgau vorgestellt.
- Im Tagungssaal waren weiter die Posterstände untergebracht, die zu folgenden Themen die Aufmerksamkeit der Teilnehmer erlangten:
- Friedrich der Große und Torgau – in Zeitungsartikeln besprochen und auf Ansichtskarten festgehalten (Dr. K. Landschreiber)
- Neidhardt von Gneisenau und die Stadt Schildau, Ausstellungsstand des Schildbürger-Museums Schildau (W. Cernik) sowie Gneisenau-Gedenkstätte Sommerschenburg (Dr. F. Bauer)
- Erinnerungen an die Befreiungskriege (D. Arlt)
- Über einige Maßnahmen gegen die napoleonische Bedrohung von Berlin und Brandenburg im Jahr 1813 (Prof. H.-J. Paech)
- Flankenkasematten der preußischen Festung Torgau (N. Lange)
- Statik der Jahrhunderthalle in Breslau (N. Lange)
- Auslagen zur Militär- und Festungsgeschichte (Dr. M. Klöffler)
Eine Ausstellung von Aquarellen zum Thema "Natur und Festung" wurde eröffnet. Ziel dieser Exposition war, das Thema Festung Torgau über den Weg der Kunst den Menschen näher zu bringen. 60 Aquarelle der Torgauer "Malgruppe 725", Ltg. Sieglinde Lawrenz, konnten betrachtet werden.
Die Exkursion zum Abschluss der Tagung führte die Teilnehmer zur noch erhaltenen rechten Flankenkasematte (Defensionskasematte mit Unterbringungsteil für die Mannschaft) der Bastion VII der (preußischen) Festung Torgau. Es handelt sich hierbei um eine Kasematte von insgesamt 14 solcher Bauten mit meistens fünf Tonnengewölben; a 18 m lang, 4,5 m breit, 3 m hoch; a Tonne 30 Soldaten; Bauzeit 1820-1830.
Bei der Gelegenheit wurden die jüngst restaurierten Schlusssteine aus Rundbögen der sächsischen sowie der preußischen Festung Torgau erläutert: FAR 1811(2x), FWR III. 1819 (2x), FWR III. 1820 und ein Stein von 1871.
Die Stücke entstammen solchen geschleiften Festungsbauten wie Poternen, evtl. auch Festungstoren und der revettierten Eskarpe sowie (ev.) eines Geschossladesystems.
Die Exkursion wurde vorbereitet und getragen durch Mitglieder des Sachsen-Preußen-Kollegiums des Förderverein Europa Begegnungen e.V. wie Herr D. Dudek, Herr N. Lange, Dr. K. Landschreiber, Herr A. Rohr u. a.
Zusammenfassungen der Vorträge zur Tagung:
Prof. Dr. Thomas Stamm-Kuhlmann (Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern)
Preußen und Rußland. Tauroggen und die Strategieüberlegungen der preußischen Regierung vom November 1812 bis zum Abschluss des Bündnisses von Kalisch.
Während Napoleon den Rückzug aus Moskau antrat, war Preußen noch mit Frankreich verbündet. Die Nachricht von der Schwächung der napoleonischen Armee löste in Berlin Überlegungen aus, wie man die Handlungsfähigkeit als europäische Großmacht mit dem Status von 1806 wiedergewinnen könne. Auf eigene Faust vollzog General Yorck in Tauroggen die Neutralisierung seines Korps, die für ihn nur ein Schritt zur Wendung gegen Frankreich sein konnte. König Friedrich Wilhelm III. ließ sich dagegen von einer wachsenden Stimmung in der preußischen Bevölkerung zu dem Entschluss treiben, am 26. Februar 1813 mit dem Kaiser von Russland ein Offensiv- und Defensivbündnis zu schließen.
Dr. Frank Wernitz (München, Freistaat Bayern)
Die Ausgestaltung einer königlichen Idee – Vom eisernen Ordenskreuz zum vollendeten Bildwerk Eisernes Kreuz. Eine Hommage an Ferdinand Graf von Einsiedel.
Von Lauchhammer ausgehend erfuhr Ende des 18. Jahrhunderts der Eisenbildguss eine technische Blüte, wobei die Vision des Grafen Detlev Carl von Einsiedel, mit künstlerischem Verstand und technischer Sorgfalt Kunstwerke in Eisen ausführen zu lassen, grenzüberschreitend auf breite Anerkennung stieß. So begann ein gutes Jahrzehnt später auch Gleiwitz sich dem Eisenkunstguss zuzuwenden, wobei mannigfaltige wechselseitige Geschäftsverbindungen zwischen der schlesischen Hütte und Lauchhammer nachweisbar sind. Die freundschaftlichen Beziehungen zwischen Graf Detlev Carl von Einsiedel und dem preußischen Minister von Heynitz waren dabei nicht nur für die Entwicklung des Gleiwitzer Kunstgusses förderlich, sondern fanden auch Niederschlag in personellen Angelegenheiten. Neben dem Austausch von Formern und Gießern stellt die Berufung Ferdinands zum Nachfolger Graf Redens als Leiter des Oberbergamtes Breslau, später Brieg und Berghauptmanns von Schlesien einen Höhepunkt dar. Dessen Einbindung in den Gestaltungsprozess für ein in Eisen gegossenes Ehrenzeichen als Auszeichnung im Kampf um Preußens Freiheit und Selbstständigkeit – dem späteren Eisernen Kreuz – durch Friedrich Wilhelm III. war einerseits ein deutliches Signal der persönlichen Wertschätzung, möglicherweise aber auch eine Geste der königlichen Hochachtung vor den technischen wie künstlerischen Fertigkeiten der Lauchhammer Gießerei.
Dr. Josef Ulfkotte (Dorsten, Nordrhein-Westfalen)
Widerstand gegen Napoleon: Der Ordensbruder Friedrich Ludwig Jahn und sein patriotisches Umfeld
Am 17. März 1813 rief der preußische König Friedrich Wilhelm III. "sein Volk" zum Widerstand gegen die napoleonische Fremdherrschaft auf. Sein Appell blieb in der Bevölkerung, insbesondere im gebildeten Bürgertum und in der akademischen Jugend nicht ungehört, zumal gezielte Aktivitäten patriotischer Kreise nach der desaströsen Niederlage der preußischen Truppen in der Schlacht bei Jena und Auerstedt (1806) dafür den Boden bereitet hatten. Neben Ernst Moritz Arndt zählte Friedrich Ludwig Jahn in diesen Jahren zu den wirkungsmächtigsten Propagatoren des antifranzösischen Widerstandes. Dabei konnte er auf frühere Mitglieder des geheimen studentischen Ordens der Unitisten zurückgreifen, dem er 1798 in Halle beigetreten war. In Lübeck erschien 1810 sein unter den Bedingungen der französischen Besatzung entstandenes Hauptwerk "Deutsches Volksthum", im Herbst des Jahres gründete er in Berlin gemeinsam mit Karl Friedrich Friesen den geheimen "Deutschen Bund". Mit Friesen entwarf Jahn 1811/12 die "Burschenordnung", die bei der Gründung der Jenaer Burschenschaft Pate stand. Um die männliche Jugend auf den Kampf gegen die napoleonische Unterdrückung vorzubereiten, eröffnete er im Juni 1811 auf der bei Berlin gelegenen Hasenheide den ersten öffentlichen Turnplatz, der in den nächsten Jahren zahlreiche Turnplatzgründungen – vornehmlich in Norddeutschland – nach sich zog. Mit den älteren Turnern der Hasenheide schloss er sich 1813 dem Lützowschen Freikorps an.
Dr. Roland Müller (Dresden, Freistaat Sachsen)
Breslau im Jahrhundertjahr
Die Ausstellung, die Feiern der Freiheitskriege von 1813 und die Jahrhunderthalle als Ort und Denkmal für das Jahrhundertereignis
Der Referent schilderte wie lebendig in Breslau im Jahr 1913 die Erinnerung an die Volkserhebung von 1813 noch war. Der Bogen wurde dabei geschlagen vom Bau der Jahrhunderthalle, ihrem Bauherrn und dem Architekten, über die Feierlichkeiten zu ihrer Eröffnung mit dem eigens dazu geschaffenen Festspiel von Gerhart Hauptmann bis zur historischen Ausstellung. Mit der Skizzierung der zahlreichen weiteren sehr unterschiedlichen Veranstaltungen aus Anlass des Jubiläums wird erkennbar, wie groß die Ausstrahlung der Jahrhundertfeier von 1913 über Breslau hinaus war. Analysiert wurde dabei auch, wie es dazu kam, dass im Volk, d.h. in großen Teilen des Bürgertums und in der Arbeiterschaft, überwiegend eine andere Sicht auf das Jahrhundertereignis bestand als im preußischen Königshaus, im schlesischen Adel und in einer kleineren Gruppe des Bürgertums, die sich zur Herrschaftselite zählte. Dazu wurden die Ereignisse des Jahres 1813 in Breslau und deren Vorgeschichte in Erinnerung gerufen. Im Zusammenhang mit der Absetzung des Festspieles, die zu einem weit beachteten Eklat führte, wird die zwiespältige Sicht auf die historischen Ereignisse 1813 nochmals sichtbar. Zugleich wurden anhand der Akten des Breslauer Magistrats Hintergründe der Jahrhundertfeier und Episoden aus ihrem Verlauf geschildert, die heute vielfach in Vergessenheit geraten sind.
Dr. Thomas Lindner (Bad Honnef, Nordrhein-Westfalen)
Gneisenau und die preußischen Militärreformen
August Neidhardt von Gneisenau war neben Gerhard von Scharnhorst der führende Kopf der preußischen Militärreformen zwischen 1807 und 1813. Nach dem frühen Tod Scharnhorsts in Folge einer bei Großgörschen 1813 erlittenen Verwundung wurde er als Blüchers Generalstabschef zum Kopf des erfolgreichen Feldzugs zur Befreiung Deutschlands von der Napoleonischen Herrschaft, der im Juni 1815 auf dem Schlachtfeld von Belle Alliance / Waterloo sein Ende fand. Der Vortrag lieferte ein Lebensbild Gneisenaus, der 1760 im sächsischen Schildau (bei Torgau) geboren wurde, vornehmlich anhand eigener und fremder Zeugnisse aus den zeitgenössischen Quellen. Auf diese Weise entsteht ein umfassendes und manchmal überraschendes Portrait des Mannes, der kongenial zu Scharnhorst, aber dennoch auf eine ganz eigene und leidenschaftliche Art, die preußischen Militärreformen in den allgemeinen Prozess der Staats- und Bildungsreformen Steins, Hardenbergs und Humbolts einzuordnen wusste.
Dr. Martin Klöffler (Düsseldorf, Nordrhein-Westfalen)
Die Elbe verteidigen – Feldbefestigungen im Herbst 1813
Der Vortrag analysierte den Einfluß der Feldbefestigungen entlang der Elbe auf die Verteidigungsstrategie der Franzosen und die Angriffsstrategie der Alliierten im September – Oktober 1813 aus der klassischen Sicht eines Generalstäblers. Ein Fluß kann immer nur als ein Hindernis angesehen werden, welches den Feind höchstens einige Tage aufhält. Die Bautechnik wurde im Vortrag aus taktisch-ingenieurtechnischer Perspektive vorgestellt und die realisierten Feldbefestigungen wurden an Hand von Beispielen erläutert. Ein ganzes Befestigungssystem, wie die Elblinie, hat keinen Eigenwert, sondern gewinnt seine Geltung nur in Zusammenhang mit Operationen der Feldarmee.
Prof. Dr. Rudolf Jenak (Dresden, Freistaat Sachsen)
Das Königreich Sachsen in der Kampagne von 1813 Dokumente des sächsischen Kabinetts
Der Vortrag widmete sich politischen Dokumenten, die von der königlich-sächsischen Regierung im Hinblick auf den bevorstehenden bzw. bereits im Gange befindlichen Krieg Frankreichs und des Rheinbundes gegen Rußland im Jahre 1812 beschlossen wurden. Ausführlich wurde ein Text des Historikers und Hofrats Carl August Böttiger kommentiert, der die moralische Notwendigkeit begründete, an der Seite des großen Kaisers Napoleon gewaltsam gegen das reaktionäre brutale und äußerst rückständige Regime Russlands vorzugehen. Ein ebenfalls im Frühjahr 1812 fertig gestelltes statistisches Werk des Geheimen Kabinetts über die territoriale, agrarische und sozial-ökonomische Beschaffenheit der westlichen Gouvernements Russlands sollte Aufschluss geben, mit welchen Gegebenheiten die sächsischen Behörden es bei der Wiederherstellung des Königreichs Polen im erhofften Ergebnis dieses Krieges zu tun haben würden. Die Instruktion des sächsischen Kabinettsministers, des Grafen von Senfft-Pilsach, für den nach Wilna, in das Hauptquartier des Kaisers Napoleon, entsandten Vertreter des sächsischen Königs, des Generalmajors von Watzdorf, verdeutlichte die aktuelle Interessenlage des sächsischen Hofes im Zuge dieser Kampagne. Die Dokumente über die Verfolgung des antifranzösischen Tugendbundes, speziell seines vermeintlichen prominenten Vertreters, des flüchtigen ehemaligen preußischen Polizeidirektors Julius Gruner, sowie die Vorgänge um die beiderseits erwünschte Beilegung des Enklaven-Problems entlang de preußisch-sächsischen Grenze, die das entspannte Verhältnis beider Staaten seit Abschluss des französische-preußischen Allianz-Vertrages vom Februar des Jahres charakterisierten, rundeten die beabsichtigte Darstellung diese Aspektes des Jahres 1812 ab.
Prof. Dr. Reiner Groß (Kreischa OT Lungkwitz, Freistaat Sachsen)
Banner der freiwilligen Sachsen
Das Kurfürstentum Sachsen in den Grenzen vom Sommer 1806 war nach der militärischen Niederlage an der Seite Preußens bei Jena von Napoleon mit dem Vertrag von Posen im Dezember 1806 in den Rheinbund gezwungen worden. Danach blieb das zum Königreich erhobene Sachsen unter König Friedrich August I. bis zur Niederlage Frankreichs in der Völkerschlacht bei Leipzig im Oktober 1813 der Bündnispartner Frankreichs. In diesen sieben Jahren von 1806 bis 1813 gab es in Sachsen keine Erhebung gegen die napoleonische Herrschaft, obwohl es zunehmend eine Opposition in Sachsen gab. Es waren einflussreiche sächsische Adelige und leitende Staatsbeamte, die sich um Dietrich von Miltitz auf Siebeneichen zusammengefunden hatten. Dieser Siebeneichener Kreis versuchte seit 1809, eine Loslösung von Frankreich zu erreichen. Dies scheiterte aber nicht nur an König Friedrich August I. und seinen Ratgebern, sondern nach dem Rußlandfeldzug 1812 auch an den territorialpolitischen Zielen Preußens und Rußlands, trotz guter persönlicher Verbindungen der Reformer zu Reichsfreiherr Stein und Zar Alexander I. Erst nach dem Oktober 1813 konnten Miltitz und Carlowitz unter dem Generalgouvernement ihre Pläne für eine Volksbewaffnung verwirklichen. Die Bildung des "Banner der freiwilligen Sachsen" war der Höhepunkt dieser Bestrebungen. Trotzdem konnten die Angehörigen des Siebeneichener Kreises die Teilung des Königreiches Sachsen mit dem Vertrag von Preßburg vom 18. Mai 1815 nicht verhindern.
Dr. Gerhard Müller (Jena, Freistaat Thüringen)
Die wettinischen Staaten in napoleonischer Zeit
Der Beitrag strebte einen Überblick über die Situation und Entwicklung der sächsischen Staatenwelt in den Jahren der napoleonischen Hegemonie zwischen der Schlacht bei Jena und Auerstedt 1806 und der Leipziger Völkerschlacht 1813 an und hat diesen aber vornehmlich aus der Perspektive eines dieser Staaten, des Herzogtums Sachsen-Weimar-Eisenach, vorgenommen.
Zunächst wurde die politische Stellung der sächsischen Staaten im Rheinbund, die ihnen zugedachte Funktion in der politischen Architektur des französischen Hegemonialsystems und die sich daraus ergebenden Handlungs- und Entwicklungsspielräume betrachtet. Dabei wurde gezeigt, dass die sächsischen Staaten anders als die Rheinbundstaaten im Süden und Westen Deutschlands nicht nur weitestgehend in ihrer aus dem alten Reich überkommenen Territorial- und Verfassungsstruktur verblieben, sondern dass die französische Hegemonialmacht sich hier auch bewusst auf die Herrschaftstradition der Wettiner stützte und die sächsischen Staaten ungeachtet des in der Rheinbundakte proklamierten Souveränitätsprinzips als einen dynastischen Territorialverbund unter der Suprematie der zur Königswürde erhobenen albertinischen Linie in Dresden betrachtete. Die damit gegenüber dem traditionellen Gegenspieler Brandenburg-Preußen deutlich aufgewertete politische Position der Wettiner korrespondierte mit einer im Vergleich zu anderen Rheinbundstaaten weitaus größeren Autonomie im Innern sowie einer durch die Personalunion der sächsischen Königswürde mit dem Großherzogtum Warschau, die an die politischen Ambitionen Augusts des Starken anknüpfte, noch verstärkten kulturellen Brückenfunktion zwischen Ost- und Westeuropa. Ob und wie die sich aus dieser Ausgangslage ergebenden Chancen genutzt werden konnten, wurde abschließend exemplarisch anhand der Politik Sachsen-Weimar-Eisenachs erörtert.
Inhalte der Podiumsdiskussionen nach den beiden Vortragsblöcken:
Sachsen und Preußen – teleologische Geschichtsschreibung?
Dr. U. Niedersen
Von dem Historiker Treitschke wird gesagt, dass er in dem geschichtlichen Werdegang Preußens keinen Sinn fand. Das wollte er nicht so auf sich beruhen lassen und erfand für das preußische Tun einen Sinn: eine Berufung zur Macht, etwa die deutsche Einheit herzustellen.
Eine solche teleologische Geschichtsschreibung hat den großen Nachteil, dass die Antwort schon in der Fragestellung bzw. durch das vorab zugrunde gelegte Motto mitgeliefert wird. Bei dieser Art Geschichtsschreibung büßt die Zukunft ihre Offenheit ein. Folglich hat diese Methode mit Wissenschaft wenig gemein.
Um so mehr hat es mich verwundert, dass ein bekannter sächsischer Historiker vor nicht allzu langer Zeit einen Aufsatz zum Thema “Sachsens geschichtlicher Auftrag“ abfasste. Hierin vermerkt er: Die Selbstbeschränkung und der friedlichen Grundhaltung Kursachsens stand der preußische Wille zur Macht mit der logischen Folge der Expansion bei jeder sich bietenden Gelegenheit gegenüber.
Das ist hier so wie bei Treitschke, eben nur von der anderen Seite her sich dem Gegenstand nähernd.
Aber, Geschichtsschreibung ist nun einmal erzählend. Sie teilt der Öffentlichkeit mit, wie es war. Einen Sinn oder gar Gesetze in der Geschichte fest zu machen, funktionierte vor der Wende „in unseren Breiten“ auch schon nicht.
Prof. Dr. R. Groß
Ausgehend von der Auffassung eines sächsischen Landeshistorikers, die von Dr. Niedersen einleitend angesprochen wurde, dass der geschichtliche Auftrag Sachsens in umfassenden Leistungen in Wirtschaft, Kultur und Wissenschaft im Gegensatz zur politisch-militärisch ausgerichteten Entwicklung Preußens stehe, wurde über diese These als einem ersten Schwerpunkt in Bezug auf das Kolloquiumsthema diskutiert. Es wurde darauf hingewiesen, dass die Markgrafen von Meißen, die späteren Kurfürsten und Könige von Sachsen ebenso wie die Markgrafen und Kurfürsten von Brandenburg und späteren Könige von Preußen bestrebt waren, ihren territorialen Herrschaftsbereich zu erweitern. In diesem Bestreben waren die Wettiner spätestens nach 1763 weniger erfolgreich als die Hohenzollern. Letztlich sollte man nicht von einem Auftrag in der geschichtlichen Entwicklung in retrospektiver Betrachtung sprechen, da es immer um das Bemühen des Historikers zu gehen habe, einen objektiv abgelaufenen Prozess zu erfassen.
Prof. Dr. R. Jenak
Die Rivalität zwischen Kursachsen und Kurbrandenburg zeigte sich deutlich darin, dass nach dem Erwerb der polnischen Krone durch Kurfürst Friedrich August I. im Jahre 1697 der Kurfürst von Brandenburg, Friedrich III., sich in Königsberg krönen ließ, den Titel Friedrich I., König in Preußen annahm.
Während der Herrschaft des Sohnes dieses Königs, Friedrich Wilhelm I., gab es neben Begegnungen und Gemeinsamkeiten auch wiederholt Differenzen um territoriale Fragen, z. B. in Danzig und Elbing, die allerdings durch Unterhandlungen beigelegt werden konnten.
Es wäre nicht korrekt, zu behaupten, nur die preußische Seite sei darauf erpicht gewesen, ihren politischen und ökonomischen Einfluss zu erweitern. Im ersten Schlesischen Krieg, den König Friedrich II. 1740 gegen Österreich vom Zaune brach, fand er die wohlwollende Unterstützung durch Kursachsen, das dabei die Hoffnung hegte, in seinem Streben nach einer Landbrücke von Sachsen nach Polen begünstigt zu werden. Die Rivalität Preußens gegenüber Sachsen bestand aber gerade darin, dass Friedrich II. gar nicht daran dachte, einen solchen Vorteil zu gewähren.
Dr. G. Müller
Ich plädiere gegen die Konstruktion eines teleologischen Geschichtsbildes, das Sachsen (oder auch Preußen) eine irgendwie vorbestimmte historische Aufgabe zuweist, wie das z. B. Treitschke bezüglich Preußens Bedeutung für die Einheit und Staatlichkeit der Deutschen getan hat. Ein solches teleologisches Geschichtsbild würde die Annahme voraussetzen, dass es Persönlichkeiten (oder Gruppen von Menschen) gibt, denen eine solche Zielstellung bereits Jahrzehnte oder Jahrhunderte, bevor sie auf der historischen Tagesordnung steht, geistig präsent ist und von ihnen verfolgt wird. Überlegungen dieser Art führen in einen mystischen Bereich, da sie gleichsam die Annahme übermenschlicher Wissensinhalte und Erkenntnisfähigkeiten implizieren, die es schlechthin nicht gibt. Preußens historische Rolle war nicht vorherbestimmt, und es gab immer wieder Situationen, in denen es auch ganz anders hätte kommen können und nur historische Zufälle (wie z. B. der Tod der russischen Zarin Elisabeth und die Machtübernahme der preußenfreundlichen Zarin Katharina II. im Siebenjährigen Krieg) dafür verantwortlich waren, dass Preußen nicht unterging und es so kam, wie wir es aus den Geschichtsbüchern kennen. Was es aber gibt, sind Traditionen, die von historischen Erfahrungen über Generationen hinweg durch die anhaltende Kontinuität analoger Interessenslagen (wie z. B. die geopolitische Mittellage Sachsens im Expansionsbereich Brandenburgs resp. Preußens und anderer benachbarter Mächte) immer wieder bestätigt und ausgeformt werden. So kann man etwa in Sachsen von einer Politik- und Verwaltungstradition sprechen, die darauf gerichtet war, die ökonomischen und kulturellen Ressourcen als Stabilitätsfaktor und Alternative zur Machtstaatspolitik zu entwickeln und zu nutzen, was nicht ausschloss, dass in bestimmten Situationen, wie wir etwa in dem Beitrag von Prof. Jenak zu 1812 hörten, auch Staatsmacht- und Expansionsambitionen zum Tragen kommen konnten.
Tradition und Wertebezug
Dr. Th. Lindner
August Neidhardt von Gneisenau war neben Gerhard von Scharnhorst der herausragende Protagonist der preußischen Heeresreformen in der Zeit zwischen 1807 und 1813. Als Generalstabschef der Schlesischen Armee an der Seite des Feldmarschalls Blücher hatte er zudem an der Befreiung Deutschlands von der Napoleonischen Herrschaft und dessen endgültiger militärischer Niederlage bei Waterloo/Belle Alliance im Juni 1815 maßgeblichen Anteil.
Neben dem eher bedachtsamen Scharnhorst und dem aristokratischen Minister vom Stein war Gneisenau ein glühender Idealist und Patriot, der die einzelnen Maßnahmen der preußischen Heeresreform mit Eifer und nimmermüder Energie verfocht. Bereits bei der erfolgreichen Verteidigung der Festung Kolberg hatte er unter Beweis gestellt, zu welchen Erfolgen mitreißende Menschenführung, Entschlossenheit und Führen durch Beispiel im Stande waren.
Zugleich haben mit dem heutigen Wissen Gneisenaus flammende Aufrufe und sein romantisches Pathos auch etwas Erschreckendes. Zudem gilt es zu bedenken, dass er in jeweils unterschiedlicher Interpretation traditionsbildend für die preußische Armee der Kaiserzeit, für die Wehrmacht, für die Nationale Volksarmee der DDR und heute auch für die Bundeswehr war bzw. ist. Dies bedarf zumindest der Erläuterung.
Gneisenaus Denkschriften, Briefe und Artikel lagen zeitlich weit vor dem Traditions- und Zivilisationsbruch des Zweiten Weltkriegs. Die verheerenden Erfahrungen eines rassenideologischen Vernichtungskrieges, eines unbeschränkten Partisanenkrieges und der auf ihn folgenden Repressionen waren noch nicht erlebt. Vor allem aber kennzeichnete ein klarer Wertebezug Gneisenaus Tätigkeit und seine publizistischen Aktivitäten: Freiheit, Menschenwürde, Rechtsstaatlichkeit und Selbstbestimmung des Individuums waren feste Größen seines Denkens und Handelns.
In diesem Wertebezug liegt vielleicht die engste Verbindung mit seinem Ururenkel, Oberst Claus Schenk Graf von Stauffenberg. So ist es nur folgerichtig, dass neben den eigenen Traditionen aus mehr als 50 Jahren Bundeswehr die preußischen Heeresreformen, der militärische Widerstand gegen Hitler und das NS-Regime die drei tragenden Säulen des Traditionsverständnisses unserer Streitkräfte in der Demokratie sind.
Dr. F. Wernitz
Das Bündnis mit Preußen und die Gestellung eines preußischen Hilfskorps hatte in den Planungen Napoleons stets nur eine untergeordnete Rolle gespielt. Vielmehr sollte das Land als Aufmarsch-, Versorgungs- und Rekrutierungsgebiet für die Grande Armée im Krieg gegen Russland dienen. Obwohl voller Verzweiflung über den politischen Kurs der Regierung rund 30 preußische Offiziere, darunter Gneisenau, Hermann von Boyen (1771–1848), Karl Wilhelm von Grolmann (1777–1843) und Karl von Clausewitz (1780–1831) ihren Dienst quittierten, gehorchte die Armee. Allerdings wirkten diese Patrioten auch im Ausland für eine Befreiung Preußens und Deutschlands vom napoleonischen Joch.
Dr. J. Ulfkotte
Aus heutiger Sicht betrachtet amüsieren wir uns vielleicht über einzelne Passagen in Jahns 1810 erschienenem Hauptwerk „Deutsches Volksthum“, andere lehnen wir zu recht wegen ihrer völkischen bzw. chauvinistischen Tendenzen ab. Aus der kritisch-distanzierten Sicht des Historikers ist dieses Werk dennoch eine wichtige Quelle zur deutschen Geschichte im Zeitalter Napoleons, weil sie den Blick freilegt auf die Bestrebungen und Vorstellungen einer kleinen Gruppe nationaldeutscher Patrioten um den Freiherrn v. Stein u.a., die nicht nur die Beseitigung der französischen Fremdherrschaft erstrebten, sondern auch die Gründung eines deutschen Nationalstaates. Verstehen und differenziert beurteilen lassen sich Jahns nationaldeutsche Aktivitäten nach dem Desaster von 1806/07 nur aus der Zeit selbst heraus. In der wechselvollen deutschen Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts sind je nach politischer und gesellschaftlicher Interessenlage „Jahnbilder“ produziert worden, die sich bei genauerem Hinsehen als Zerrbilder erweisen und letztlich mehr über die Zeit aussagen, in der sie entstanden, als über Werk und Wirken Jahns selbst.
Prof. Dr. Th. Stamm-Kuhlmann
Heute hat das Gedenken an Friedrich Ludwig Jahn eine Form angenommen, bei der man Jahns Text „Deutsches Volkstum“ gerne übergeht, weil der Text im Jahre 2012 nicht als zeitgemäß empfunden wird.
Eine Tendenz in der Ausgestaltung des Gedenkens ist legitim, wenn diese Tendenz sichtbar gemacht wird und keine wesentlichen Geschichtstatsachen unterschlagen werden.
Die Forderung, man möge Personen wie Friedrich Ludwig Jahn oder Ernst Moritz Arndt „aus ihrer Zeit verstehen“, ist hingegen dann gerechtfertigt, wenn Maßstäbe drohen an diese Personen angelegt zu werden, die zu ihren Lebzeiten noch nicht zur Verfügung standen.
Hier befindet man sich allerdings wiederum oft im Irrtum. Es gibt bedeutende Zeitgenossen von Arndt und Jahn, die, wie Goethe, der Greifswalder Dichter Kosegarten oder Heinrich Heine, die sich den Franzosenhass nie zu eigen gemacht haben. Diese Tatsache deutet darauf hin, dass sich für Arndt und Jahn sehr wohl eine Alternative zu ihrer Haltung geboten hat.
Auch der Antisemitismus, der sich bei manchen deutschen Patrioten der Befreiungskriege und des Vormärz zeigte, war nicht ohne Alternative. Nicht alle Zeitgenossen waren Judenhasser oder wollten die Juden aus dem Volk ausschließen. Lessings „Nathan der Weise“ gehörte bereits zum Bestand der deutschen Literatur.
Breslau 1813, 100 Jahre danach
Prof. Dr. Th. Stamm-Kuhlmann
Das Beispiel der Jahrhundertfeier in Breslau 1913 zeigt, dass jedes Gedenken mit einer Absicht verbunden ist, die aus der jeweiligen Gegenwart stammt. Die liberalen Stadtväter von Breslau hatten 1913 die Absicht, dem konservativen preußischen Königshaus eine Botschaft zu übermitteln: Man möge aus den Ereignissen der deutschen Erhebung des Jahres 1813 die Schlussfolgerung ableiten, dass dem Volk mehr Vertrauen entgegen gebracht und die Politik daher demokratisiert werden könne. Dies gelte erst recht im Jahre 1913, wo man es an Treuebekundungen gegenüber dem Herrscherhaus nicht fehlen lassen werde.
Dr. R. Müller
Die Geschichte der Jahrhunderthalle in Breslau ist ein typisches Beispiel für die wechselvolle Geschichte in den Beziehungen zwischen Deutschland und Polen. Das Bauwerk, mit dem Breslau im deutschen Kaiserreich zu Beginn der zweiten Dekade des vergangenen Jahrhunderts auf sich aufmerksam gemacht hat, erlebte schon 1913 stürmische Tage. Gerhart Hauptmann hatte mit seinem zur Eröffnung der Halle geschriebenen „Festspiel in deutschen Reimen“ auch den gesellschaftlichen Fortschritt und die Sehnsucht nach Frieden gefeiert und damit den Unwillen der seinerzeit Herrschenden hervorgerufen. Nach Jahren als Lebensmittellager während des ersten Weltkrieges war das Bauwerk nach der Novemberrevolution 1918 der erste Versammlungsort der Breslauer Arbeiter, Soldaten und Bürger und wurde dabei von Max Berg als „Dom der Demokratie“ geweiht. Das Gegenteil davon, das Ende jeder demokratischen Kultur, verkündete Adolf Hitler 1933 in der Halle. Nach dem Zweiten Weltkrieg erlebte sie im nunmehr polnischen Breslau/Wroclaw eine neue Nutzung. Dass sie, inzwischen sehr sorgfältig saniert und restauriert, sowie seit 2006 auf der UNESCO-Weltkulturerbeliste stehend, in der Oderstadt eine große kulturelle Bedeutung besitzt, ist nicht zuletzt auch Ausdruck des Respekts gegenüber dem deutschen Bauherren, dem Magistrat der schlesischen Provinzhauptstadt und dessen Stadtbaurat Max Berg, der für dieses Bauwerk verantwortlich war. Die Weltoffenheit und Aufgeschlossenheit sehr vieler ihrer Einwohner gegenüber der deutschen Vergangenheit der Stadt wird an ihrem Beispiel sichtbar. Breslau mit dieser Halle, den darin stattfindenden Veranstaltungen und seinen Museen ist immer einen Besuch wert.
Weitere Tagungen
Mitteilung über Themen und Termine der folgenden wissenschaftlichen Tagungen in Torgau, Schloß Hartenfels:
24. und 25. Mai 2013 – Schlachten und Befestigungen. Die Situation vor der Völkerschlacht bei Leipzig.
11. und 12. Oktober 2013 – Länder, Festungen und Armeen, deren Siege und Kapitulationen. Wien: Das neue „Alte Europa“
Dr. Uwe Niedersen
Die Berichterstattung von Torgau-TV finden Sie hier:
Tagung der Festungsforscher und Historiker am 12. und 13. Oktober 2012 auf Schloss Hartenfels in Torgau