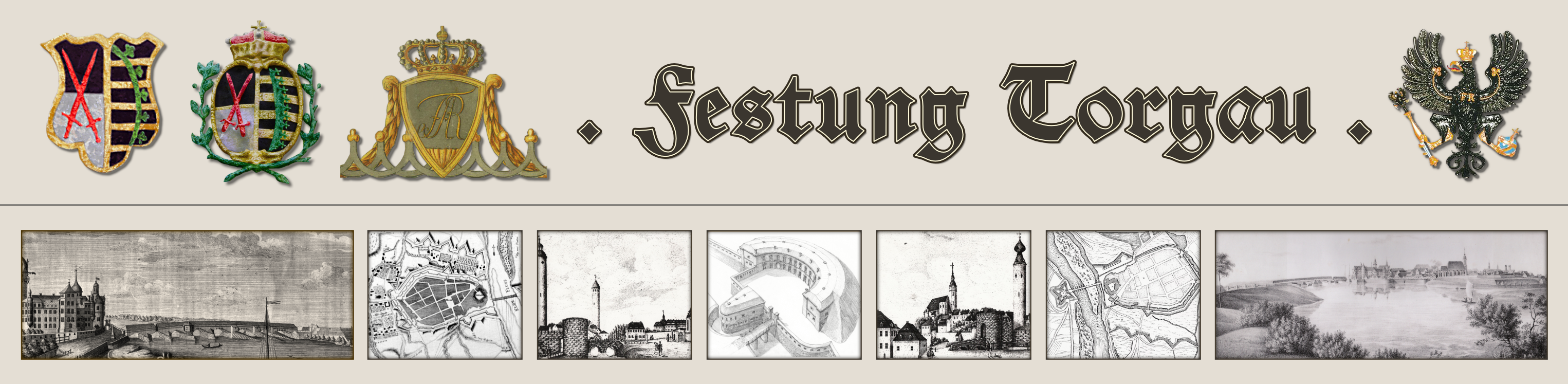
Tagung der Historiker und Festungsforscher
Torgau/Elbe, 29., 30. und 31. Oktober 2010
200 Jahre Sächsische Elb- und Landesfestung Torgau,
Edikt vom November 1810 und 250 Jahre Schlacht bei Torgau,
3. November 1760 (Teil II)
Ort: Aula des Johann-Walter-Gymnasium, Schloßstraße. 7/9, 04860 Torgau
R e s ü m e e
Torgau/Elbe, 29., 30. und 31. Oktober 2010
200 Jahre Sächsische Elb- und Landesfestung Torgau,
Edikt vom November 1810 und 250 Jahre Schlacht bei Torgau,
3. November 1760 (Teil II)
Ort: Aula des Johann-Walter-Gymnasium, Schloßstraße. 7/9, 04860 Torgau
R e s ü m e e
Die zehnte Tagung der Festungsforscher und Historiker wurde im Jahr des doppelten Gedenkens, 200 Jahre Festung und 250 Jahre Schlacht bei Torgau (siehe Tagungsthema), vom Förderverein Europa Begegnungen e. V., Torgau und seinem Sachsen-Preußen-Kollegium in der ehemaligen Klosterkirche der Franziskaner, heute Aula des Gymnasiums, durchgeführt.
In die Tagungsmappe wurden, neben der Adressenliste und dem Tätigkeitsprofil der Teilnehmer, folgende Stücke beigefügt:
- Österreich und die Schlacht bei Torgau. „Ziethen aus dem Busch“ und „Die Königin der Nacht“; Exposé von Univ.-Prof. Dr. Lothar Höbelt (Wien)
- Die Festung Torgau aus denkmalpflegerischer Sicht. Aufsatz zum „Tag des offenen Denkmals“, 2010, von Dr. Steffen Delang (Dresden)
- Die Torgauer Schlosskirche – sichtbarer Ausdruck der lutherischen Reformation als religiöses und politisches Bekenntnis; Vortrag, gehalten von Pfarrer Hans-Christian Beer zum Kirchweihgedenken in der Schlosskirche zu Torgau, am 5.10.2010
In der Aula befanden sich der Büchertisch mit aktueller Literatur zum Tagungsthema. Der Veranstalter der Tagung, der Förderverein Europa Begegnungen e. V., konnte zur Tagung wiederum einem Schrift zur Festung Torgau vorstellen und herausgeben.
Zur Festung Torgau können nunmehr folgende Bände beim Veranstalter bezogen werden:
Die Festung Torgau. Der Brückenkopf, 2. erweiterte Auflage, Oktober 2010, 80 S., mit 90 Abb., davon über die Hälfte in Farbe;
Die Festung Torgau. Fort Zinna, Mai 2010, 60 S. mit 50 Abb., davon 35 in Farbe.
Posterstände wurden durch Mitglieder des Sachsen-Preußen-Kollegiums im Förderverein Europa Begegnungen e. V. über Lazarette, zur Wasserbautechnik und zu Einbauten der Festung Torgau präsentiert. Der Stand zur „Artillerie der Festung Torgau um 1811/12“ wurde durch Dr. Martin Klöffler (Düsseldorf) betreut.
Die Ausstellung, getragen von der Gruppe „Leipzig 1813 e. V.“, Leiter Michél Kothe, stellte in den Mittelpunkt jene Soldaten, die während der Kämpfe in den Schlachten der napoleonischen Zeit verwundet wurden und unter unvorstellbaren Bedingungen um ihr Leben rangen.
Folgend werden einige Inhalte (Zusammenfassungen) aus den Vorträgen mitgeteilt:
General a. D. Hans-Peter von Kirchbach (Berlin) wählte für seinen Einführungsvortrag das Thema „In Freiheit Dienen. 20 Jahre Armee der Einheit“.
In seinen Ausführungen legte der Vortragende viel Gewicht auf den menschlichen Faktor des Weges zu einer Armee der Einheit. „War mein Leben umsonst?“, dies war 1990 die wichtigste Frage von Offizieren der einstigen NVA. Die Soldaten fragten: „Was wird aus mir, werde ich einen Platz in der kleineren Bundeswehr finden; werde ich meine Familie ernähren können?“
Durch die Vereinigung umfasste die Bundeswehr plötzlich 600.000 Mann, die auf 370.000 Soldaten zu reduzieren war. Es war eine Tatsache, dass Entlassungen in einem erheblichen Umfang notwendig wurden. Mittels Berufsförderungsprogrammen wurde versucht, solchen Soldaten Chancen zu verschaffen.
Aus den alten Strukturen waren die Strukturen der Bundeswehr zu entwickeln; möglichst schnell musste mit neuem Gerät die Einsatzbereitschaft hergestellt werden. Schon bei den späteren internationalen Einsätzen war sächsisch ein oft gehörter Dialekt.
Der Vortragende empfahl, auch für die Zukunft die jeweiligen Biographien auszutauschen und die unterschiedlichen Erfahrungen als gleichwertig anzunehmen.
Dr. Hansjochen Hancke (Torgau) sprach zum Thema „Torgau - Entwicklung einer Stadt“. Eine vom Referenten vorgestellte großformatige Luftaufnahme zeigte den Grundriss der Altstadt Torgau, ein städtebauliches Denkmal internationalen Ranges. Sorgfältig eingemessen (Dipl.-Ing. Norbert Lange M.A.) erschienen die noch mittelalterliche Stadtbefestigung im Verlauf um 1600 und die frühen Festungsanlagen ab 1631. Schließlich die Preußische Festung zum Zeitpunkt ihrer Komplettierung 1882, weitgehend übernommen für die Ausgestaltung des Stadtentwicklungsplans von 1895 nach Aufhebung der Festung 1889.
Dargestellt wurden die herausragende Entwicklung der Stadt in ihrer großen Zeit ab 1485, als politisches Zentrum der Reformation infolge der Residenzfunktion unter den ernestinischen Kurfüsten, der andauernde Rangverlust ab dem Schwedenjahr 1637 und das weitere Geschehen bis zur Gegenwart: „Festung als Schicksal“.
Dr. habil. Uwe Niedersen (Torgau) referierte zum Thema „Entstehungsgeschichte der Sächsischen Elb- und Landesfestung Torgau“ (Teil II und Schlussteil) Durch das Auffinden einer Chronologie über die Errichtung der Sächsischen Landesfestung Torgau konnte nun erstmals die herausragende Rolle der sächsischen Ingenieur-Offiziere Major Johann Georg Lehmann, Hauptmann Ernst Ludwig Aster und Oberstleutnant Johann August Le Coq in ihrer gegenseitigen Argumentation zum Gegenstand vorgestellt werden.
Aster erhielt beispielsweise am 6.10.1810 den Befehl, die noch in Widerspruch stehenden Le Coqschen und Lehmannschen Meinungen über eine Festung Torgau einander näher zu bringen. Le Coq hatte am 29.09.1810 einen Entwurf vorgelegt, „dem eine Deutsche insbesondere die Glasersche Manier zu Grunde“ lag; Lehmann schlug hingegen, 2.10.1810 eine 9-Bastionen Festung nach Vauban/Cormontaingne vor.
Später sollte Napoleon Ähnliches, wie Lehmann es vorgeschlagen hatte, anordnen; allerdings auf 8 Bastionen reduziert, so dass die Vorstädte Torgaus geopfert werden mussten. Ausführlich wurde im Vortrag dargelegt, was Aster bei Napoleon in Paris an Eigenem durchsetzen konnte, wobei der Kaiser in Anbetracht des bevorstehenden Feldzuges gegen Russland bezüglich Torgau auf eine „offensive“, d. h. auf eine „Kampagne-Fortifikation“ beharrte. Aus dieser Sicht wurde von ihm folglich angeordnet, 1811 das Hauptwerk erdgeschüttet zu vollenden und erst danach, 1812, die wichtigsten Außenwerken zu errichten. Dabei blieb Torgau stets eine „Sächsische Elb- und Landesfestung“. Eine „Sächsisch-Napoleonische Festung Torgau“, wie der Titel einer für 2011 vorgesehenen großen Sonderausstellung der Stadtverwaltung Torgau mit dem hiesigen heimatlichen Geschichtsverein lauten soll, hat es zu keinem Zeitpunkt in der Geschichte Torgaus gegeben.
Dr. Martin Klöffler (Düsseldorf) untersuchte die Rolle der sächsischen Festungsartillerie bei der Belagerung von Torgau. Er hob die Besonderheiten der sächsischen Lafettenkonstruktionen hervor.
Nach dem Siebenjährigen Kriege wurde die sächsische Feldartillerie mit Kalibern 4-8-12 Pfund unter Hoyer neu aufgebaut. Die Defensions- und Belagerungsartillerie verblieb überwiegend bei dem alten Material.
Nach den Spezifikationen des Major Raabe hatte man vor, das sächsische Artilleriematerial ab 1810 auf die neuen Kaliber 6-12-18 Pfund, Rohre und Lafetten, umzurüsten. Die stehenden Mörser sollten durch hängende Mörser der Kaliber 24-32-48 Pfund ersetzt werden, die indessen erst nach 1816 zur Einführung kamen. Eine gesonderte Garnisonsartillerie gab es nicht, vielmehr wurden die Mannschaften bei Bedarf dem Feldartilleriecorps entnommen.
Genuin sächsische Lafetten lassen sich bei den Walllafetten, Haubitzen und Mörser nachweisen. Es ist dagegen nicht sicher, ob die Gribeauval- (Walllafetten auf Rahmen) und Montalembert-Lafetten (Kasemattlaffeten auf Rahmen) zu Anwendung kamen.
Die Ballistik von Kanonen, Haubitzen und Mörsern und deren Wirkung auf Festungswerke sowie Feldverschanzungen wurden ebenso wie die Funktion und Bauweise der Belagerungs-batterien vorgestellt.
Der Armierungsplan in der „Commissions Acte“ 1812 für die Festung Torgau mit 186 Geschützen stimmt recht gut mit der Vauban-Regel überein. Für ca. 80 dieser Geschütze waren Rahmen- oder Verlängerungslafetten vorgesehen. Die tatsächliche Armierung von Oktober 1813 nennt zwar 199 sächsische Geschütze, davon aber nur 8 x 24-Pfünder und ca. 150 veraltete 8 Pfünder, die eigentlich zur Feldartillerie gehörten. Von den Franzosen wurden 8 Gribeauval-Lafetten vor Ort gebaut, der Anteil sächsischer Walllafetten bleibt unklar. Sächsische Mörser sind seitens der Belagerer am Fort Zinna und an der Teichschanze nachgewiesen; ebenso eine Batterie von 12 Pfündern am Fort Zinna – somit verwendeten die belagernden Preußen und verteidigende Franzosen sächsisches Artilleriematerial.
Prof. Dr. Volker Schmidtchen (Dortmund) machte in seinem Vortrag deutlich, dass auch schon zur Zeit Friedrich des Großen „Technik“ im Zusammenhang mit dem Kriegswesen weitaus mehr umfasste als Bewaffnung und sonstige Ausrüstung der Streitkräfte. Dazu zählten das beherrschte technologische Know how, die Träger dieses Wissens und ihre Befähigung zur praktischen Umsetzung, die Kapazitäten der Produktionsstätten, die Eigenerzeugung von Rohstoffen, wie der Grad der Abhängigkeit von entsprechenden Importen, Bestand und technische Qualität der bei der Armee vorhandenen Waffenausstattung sowie die Arbeitsorganisation und das System der Versorgung der Truppen mit allen für die Kriegführung erforderlichen Gütern.
Der „Soldatenkönig“ Friedrich Wilhelm I. hat nie einen Krieg geführt. Sein Sohn Friedrich II. erlangte in den von ihm geführten Kriegen nicht nur den Ruhm als überaus erfolgreicher Feldherr, sondern auch als Schöpfer einer neuen europäischen Großmacht. Beide aber haben vor allem auch durch ihre wirtschaftspolitischen Maßnahmen die Grundlagen für diesen Aufstieg Preußens gelegt, indem sie durch die gezielte Förderung eigener Rüstungsbetriebe, durch den Ausbau des Hüttenwesens und das Anwerben ausländischer Spezialisten die kriegswichtigen Elemente der Wirtschaft des Landes stärkten und die Abhängigkeit von fremden Märkten für solche Güter in beträchtlichem Maße verringerten.
Der Vater von Friedrich II. hatte in einer 27jährigen Friedensperiode den Umfang des preußischen Heeres von 30.000 auf 80.000 Mann gesteigert, den Unterhalt dafür ohne übermäßige Verschuldung aufbringen und ihm noch eine gut gefüllte Staatskasse hinterlassen können. Nach 46jähriger Regierungszeit, von denen exakt die erste Hälfte durch die drei sieg- aber auch verlustreichen Schlesischen Kriege und die zweite durch einen beispiellosen Wiederaufbau des Landes geprägt gewesen war, wies die staatliche Handelsbilanz Friedrich II., mittlerweile „Alter Fritz“ genannt, bei dessen Tod einen Gewinn von ökonomisch sehr gesunden 4 Millionen Talern aus.
Dr. Thomas Lindner (Windhagen), Herausgeber des nach 1945 verschollen angenommenen Eberhard Kessel-Manuskriptes über die letzte Phase des 7-jährigen Krieges, führte aus:
Die Schlacht bei Torgau am 3. November 1760 zählt zu den heute eher weniger bekannten Ereignissen des Siebenjährigen Krieges. Friedrich der Große und der österreichische Feldmarschall Leopold Daun wollten ihre strategische Position in Sachsen festigen und waren unbedingt zum Erfolg entschlossen. Die operative Lage zwang den König, seine Armee zu teilen und auf langen Marschwegen getrennt gegen die österreichischen Linien vorrücken zu lassen. Zudem wich deren Aufstellung erheblich von seiner Disposition ab. Statt im geschlossenen Einsatz musste der König seine Truppen sukzessive ins Gefecht führen und mehrfach unter großen Verlusten die Süptitzer Höhen angreifen. Erst die erfolgreiche Umgruppierung und Verschiebung des von Süden angreifenden Korps Zieten brachte gegen Abend den unerwarteten Erfolg. Deutlich zeigten sich bei Torgau die Grenzen einer effektiven Gefechtsaufklärung sowie der Kommunikation, die den Armeen des Ancien régime gesetzt waren. Dass die Preußen schließlich trotz ihrer verheerenden Verluste die Schlacht dennoch zum Erfolg wenden konnten, war wesentlich ihrer Entschlossenheit und der taktischen Beweglichkeit vieler Unterführer zu danken, für die später der Begriff des Führens mit Auftrag geprägt wurde.
Folgend einige weiterführende Anmerkungen von Dr. Lindner, die wir hier mit zur Kenntnis geben wollen:
Mit der Formulierung „Umgruppierung und Verschiebung“ ist die doppelte Führungsleistung Zietens am Nachmittag des 3. Nov. 1760 gemeint. Zieten löste sich ja ab etwa 16:00 Uhr vom Gegner und verschob seine Truppen zunächst brigadeweise nach links in Richtung auf den Südrand von Süptitz zu. Dies führte zugleich zu einer weitgehenden Umgruppierung, denn nunmehr sind für den späteren Angriff aus dem Defilee der Schafteiche heraus Infanteriekräfte vorn (nicht mehr Kavallerieverbände, wie zunächst auf dem Marsch am Morgen auf Torgau zu) die zudem auch nicht mehr in der ursprünglichen Aufstellung fochten (die Brigade Tettennorn kämpfte z. B. zunächst gemeinsam mit der Brigade Salderb in Süptitz und in den Süptitzer Weinbergen, anschließend rückte die Brigade Saldern gefolgt von der Brigade Grumbkow ihrerseits als erste in Marschkolonne an den Schafteich vor).
Das bedeutet, dass mit hängender oder verschobener Gefechtsordnung m. E. die viel beschriebene „schiefe Schlachtordnung“ Friedrich des Großen bezeichnet ist, also die Schwerpunktbildung auf einer Flanke des Gegners, um an dieser Stelle die Linie aufzubrechen oder zu überflügeln und sie anschließend von der Seite her aufzurollen. Torgau hat man gelegentlich wegen der Teilung der Preußischen Armee als Höhe- und Endpunkt der „schiefen Schlachtordnung“ bezeichnet.
Dr. Lindner zeigte sich diesbezüglich eher etwas skeptisch, da der operative Ansatz bei Torgau sicher mehr der schwierigen Ausgangslage geschuldet war, und der so nicht geplante, beinahe katastrophale Verlauf der Schlacht für die preußischen Truppen sprach ebenfalls gegen ein solches Verhältnis.
Erkenntnisleitendes Interesse bei der kriegs- und operationsgeschichtlichen Betrachtung der Schlacht bei Torgau war grundsätzlich die Ranke´sche Frage danach, „wie es eigentlich gewesen ist“. Über das konkrete Nachvollziehen des Planungs- und Gefechtsgeschehens bei Torgau gelangt man zu übergeordneten Fragestellungen der Differenz zwischen den Theoremen absolutistischer Kriegführung und der Praxis in einer gegebenen operativen Lage. Die Teilung der Preußischen Armee und der letzte Angriff des Korps Zieten bereits in der Dunkelheit loten die Grenzen der bisherigen Lineartaktik der Armeen im Ancien régime aus, ohne sie zu dieser Zeit bereits überwinden zu können.
Mit anderen Worten:
Die Truppen griffen dann später auf den Süptitzer Höhen teils aus der Bewegung, vermutlich tief gestaffelt als Kolonne an, teils sicherlich auch in aufgelöster Ordnung. Dies ist jedoch nicht wie dann in der napoleonischen Zeit einer weiter entwickelten Taktik geschuldet, sondern den besonderen Umständen der Lage, die eine Entwicklung der Zietenschen Truppen zur Linie aus vielfältigen Gründen nicht zuließ.
Prof. Dr. Stefan Kroll (Rostock) sprach über “Die Kursächsische Armee während der drei Schlesischen Kriege (1740–1763)”.
Innerhalb des Reiches besaß Kursachsen während der längsten Zeit des 18. Jahrhunderts nach Österreich und Preußen die zahlenmäßig drittstärkste Armee. Im Mittelpunkt des Vortrags von Stefan Kroll standen der Lebensalltag und die Kriegserfahrungen von kursächsischen Unteroffizieren und Soldaten in den drei Schlesischen Kriegen (1740/42, 1744/45 und 1756/63). Anhand zahlreicher Beispiele verdeutlichte der Rostocker Historiker, der Teilergebnisse seiner Habilitationsschrift vorstellte, dass die Truppen unter dem Strich weitaus stärker durch Krankheiten, Seuchen und die Folgen von Versorgungsengpässen als durch die Auswirkungen direkter Kampfhandlungen bedroht waren. Für viele der sächsischen Soldaten bedeuteten die Schlesischen Kriege nicht viel mehr als einen ständigen Kampf um das eigene Überleben.
Prof. Dr. Jürgen Kloosterhuis (Berlin) befasste sich mit dem Thema: „Ordre, Eintrag und Porträt. Identitätsstiftung und Traditionsbildung im preußischen Offizierkorps des 18. Jahrhunderts im Spiegel seiner Schrift- und Bildquellen“. Der Vortragende rückte die Begriffe „Identifikation“ und „Tradition“ ins Zentrum seiner Ausführungen. Tradition bedeutet, dass etwas „so war, so ist und so sein wird“.
Die Identifikation der Soldaten mit der Sache erfolgte über Gewöhnung, Befehl, Kameradschaft und über die (relative) Sicherheit und Stärke der geschlossenen Formation. Bei den Preußen spielte die Gefolgschaft, die der charismatischen Figur galt, eine wichtige Rolle Friedrich des Großen.
In der Podiumsdiskussion kamen zu dieser Thematik, speziell zum Begriff „Motivation“ noch folgende Hinweise:
Eine ideologische Motivation, für die man kämpfte – für ein Vaterland oder bestimmte Werte – kann zumindest für Mannschaften und Unteroffiziere nicht festgestellt werden. Militärische Tradition beginnt sich im Verlauf des 18. Jahrhunderts in Preußen zunächst im Rahmen einer sich herausbildenden Regimentstradition zu entwickeln. Sie ist Bestandteil militärischen Zusammenhalts und damit in letzter Konsequenz auch einsatzrelevant.
Die Bundeswehr versteht Tradition als wertebezogene Auswahl aus der Geschichte. Sie hat in diesem Verständnis drei Säulen als Grundlage ihres Traditionsverständnisses definiert: Die preußischen Militärreformen Scharnhorsts und Gneisenaus, den militärischen Widerstand gegen Hitler und das NS-Regime sowie die Tradition der Bundeswehr als erster Wehrpflichtarmee in einem demokratischen Deutschland einschließlich ihrer Einsätze.
Die Exkursionen führten auf das Schlachtfeld (Süptitzer Höhen) der Schlacht bei Torgau; hier erfolgten Erläuterungen durch Dr. Lindner. Am Denkmal der Schlacht wurde der Gefallenen gedacht.
Am nächsten Tag waren das Fort Zinna und der Brückenkopf der Festung Torgau das Ziel der Exkursion. Ausführungen hierbei wurden durch Norbert Lange, Manfred Dauer, Klaus Lotzenburger vorgenommen.
Dr. Uwe Niedersen
In die Tagungsmappe wurden, neben der Adressenliste und dem Tätigkeitsprofil der Teilnehmer, folgende Stücke beigefügt:
- Österreich und die Schlacht bei Torgau. „Ziethen aus dem Busch“ und „Die Königin der Nacht“; Exposé von Univ.-Prof. Dr. Lothar Höbelt (Wien)
- Die Festung Torgau aus denkmalpflegerischer Sicht. Aufsatz zum „Tag des offenen Denkmals“, 2010, von Dr. Steffen Delang (Dresden)
- Die Torgauer Schlosskirche – sichtbarer Ausdruck der lutherischen Reformation als religiöses und politisches Bekenntnis; Vortrag, gehalten von Pfarrer Hans-Christian Beer zum Kirchweihgedenken in der Schlosskirche zu Torgau, am 5.10.2010
In der Aula befanden sich der Büchertisch mit aktueller Literatur zum Tagungsthema. Der Veranstalter der Tagung, der Förderverein Europa Begegnungen e. V., konnte zur Tagung wiederum einem Schrift zur Festung Torgau vorstellen und herausgeben.
Zur Festung Torgau können nunmehr folgende Bände beim Veranstalter bezogen werden:
Die Festung Torgau. Der Brückenkopf, 2. erweiterte Auflage, Oktober 2010, 80 S., mit 90 Abb., davon über die Hälfte in Farbe;
Die Festung Torgau. Fort Zinna, Mai 2010, 60 S. mit 50 Abb., davon 35 in Farbe.
Posterstände wurden durch Mitglieder des Sachsen-Preußen-Kollegiums im Förderverein Europa Begegnungen e. V. über Lazarette, zur Wasserbautechnik und zu Einbauten der Festung Torgau präsentiert. Der Stand zur „Artillerie der Festung Torgau um 1811/12“ wurde durch Dr. Martin Klöffler (Düsseldorf) betreut.
Die Ausstellung, getragen von der Gruppe „Leipzig 1813 e. V.“, Leiter Michél Kothe, stellte in den Mittelpunkt jene Soldaten, die während der Kämpfe in den Schlachten der napoleonischen Zeit verwundet wurden und unter unvorstellbaren Bedingungen um ihr Leben rangen.
Folgend werden einige Inhalte (Zusammenfassungen) aus den Vorträgen mitgeteilt:
General a. D. Hans-Peter von Kirchbach (Berlin) wählte für seinen Einführungsvortrag das Thema „In Freiheit Dienen. 20 Jahre Armee der Einheit“.
In seinen Ausführungen legte der Vortragende viel Gewicht auf den menschlichen Faktor des Weges zu einer Armee der Einheit. „War mein Leben umsonst?“, dies war 1990 die wichtigste Frage von Offizieren der einstigen NVA. Die Soldaten fragten: „Was wird aus mir, werde ich einen Platz in der kleineren Bundeswehr finden; werde ich meine Familie ernähren können?“
Durch die Vereinigung umfasste die Bundeswehr plötzlich 600.000 Mann, die auf 370.000 Soldaten zu reduzieren war. Es war eine Tatsache, dass Entlassungen in einem erheblichen Umfang notwendig wurden. Mittels Berufsförderungsprogrammen wurde versucht, solchen Soldaten Chancen zu verschaffen.
Aus den alten Strukturen waren die Strukturen der Bundeswehr zu entwickeln; möglichst schnell musste mit neuem Gerät die Einsatzbereitschaft hergestellt werden. Schon bei den späteren internationalen Einsätzen war sächsisch ein oft gehörter Dialekt.
Der Vortragende empfahl, auch für die Zukunft die jeweiligen Biographien auszutauschen und die unterschiedlichen Erfahrungen als gleichwertig anzunehmen.
Dr. Hansjochen Hancke (Torgau) sprach zum Thema „Torgau - Entwicklung einer Stadt“. Eine vom Referenten vorgestellte großformatige Luftaufnahme zeigte den Grundriss der Altstadt Torgau, ein städtebauliches Denkmal internationalen Ranges. Sorgfältig eingemessen (Dipl.-Ing. Norbert Lange M.A.) erschienen die noch mittelalterliche Stadtbefestigung im Verlauf um 1600 und die frühen Festungsanlagen ab 1631. Schließlich die Preußische Festung zum Zeitpunkt ihrer Komplettierung 1882, weitgehend übernommen für die Ausgestaltung des Stadtentwicklungsplans von 1895 nach Aufhebung der Festung 1889.
Dargestellt wurden die herausragende Entwicklung der Stadt in ihrer großen Zeit ab 1485, als politisches Zentrum der Reformation infolge der Residenzfunktion unter den ernestinischen Kurfüsten, der andauernde Rangverlust ab dem Schwedenjahr 1637 und das weitere Geschehen bis zur Gegenwart: „Festung als Schicksal“.
Dr. habil. Uwe Niedersen (Torgau) referierte zum Thema „Entstehungsgeschichte der Sächsischen Elb- und Landesfestung Torgau“ (Teil II und Schlussteil) Durch das Auffinden einer Chronologie über die Errichtung der Sächsischen Landesfestung Torgau konnte nun erstmals die herausragende Rolle der sächsischen Ingenieur-Offiziere Major Johann Georg Lehmann, Hauptmann Ernst Ludwig Aster und Oberstleutnant Johann August Le Coq in ihrer gegenseitigen Argumentation zum Gegenstand vorgestellt werden.
Aster erhielt beispielsweise am 6.10.1810 den Befehl, die noch in Widerspruch stehenden Le Coqschen und Lehmannschen Meinungen über eine Festung Torgau einander näher zu bringen. Le Coq hatte am 29.09.1810 einen Entwurf vorgelegt, „dem eine Deutsche insbesondere die Glasersche Manier zu Grunde“ lag; Lehmann schlug hingegen, 2.10.1810 eine 9-Bastionen Festung nach Vauban/Cormontaingne vor.
Später sollte Napoleon Ähnliches, wie Lehmann es vorgeschlagen hatte, anordnen; allerdings auf 8 Bastionen reduziert, so dass die Vorstädte Torgaus geopfert werden mussten. Ausführlich wurde im Vortrag dargelegt, was Aster bei Napoleon in Paris an Eigenem durchsetzen konnte, wobei der Kaiser in Anbetracht des bevorstehenden Feldzuges gegen Russland bezüglich Torgau auf eine „offensive“, d. h. auf eine „Kampagne-Fortifikation“ beharrte. Aus dieser Sicht wurde von ihm folglich angeordnet, 1811 das Hauptwerk erdgeschüttet zu vollenden und erst danach, 1812, die wichtigsten Außenwerken zu errichten. Dabei blieb Torgau stets eine „Sächsische Elb- und Landesfestung“. Eine „Sächsisch-Napoleonische Festung Torgau“, wie der Titel einer für 2011 vorgesehenen großen Sonderausstellung der Stadtverwaltung Torgau mit dem hiesigen heimatlichen Geschichtsverein lauten soll, hat es zu keinem Zeitpunkt in der Geschichte Torgaus gegeben.
Dr. Martin Klöffler (Düsseldorf) untersuchte die Rolle der sächsischen Festungsartillerie bei der Belagerung von Torgau. Er hob die Besonderheiten der sächsischen Lafettenkonstruktionen hervor.
Nach dem Siebenjährigen Kriege wurde die sächsische Feldartillerie mit Kalibern 4-8-12 Pfund unter Hoyer neu aufgebaut. Die Defensions- und Belagerungsartillerie verblieb überwiegend bei dem alten Material.
Nach den Spezifikationen des Major Raabe hatte man vor, das sächsische Artilleriematerial ab 1810 auf die neuen Kaliber 6-12-18 Pfund, Rohre und Lafetten, umzurüsten. Die stehenden Mörser sollten durch hängende Mörser der Kaliber 24-32-48 Pfund ersetzt werden, die indessen erst nach 1816 zur Einführung kamen. Eine gesonderte Garnisonsartillerie gab es nicht, vielmehr wurden die Mannschaften bei Bedarf dem Feldartilleriecorps entnommen.
Genuin sächsische Lafetten lassen sich bei den Walllafetten, Haubitzen und Mörser nachweisen. Es ist dagegen nicht sicher, ob die Gribeauval- (Walllafetten auf Rahmen) und Montalembert-Lafetten (Kasemattlaffeten auf Rahmen) zu Anwendung kamen.
Die Ballistik von Kanonen, Haubitzen und Mörsern und deren Wirkung auf Festungswerke sowie Feldverschanzungen wurden ebenso wie die Funktion und Bauweise der Belagerungs-batterien vorgestellt.
Der Armierungsplan in der „Commissions Acte“ 1812 für die Festung Torgau mit 186 Geschützen stimmt recht gut mit der Vauban-Regel überein. Für ca. 80 dieser Geschütze waren Rahmen- oder Verlängerungslafetten vorgesehen. Die tatsächliche Armierung von Oktober 1813 nennt zwar 199 sächsische Geschütze, davon aber nur 8 x 24-Pfünder und ca. 150 veraltete 8 Pfünder, die eigentlich zur Feldartillerie gehörten. Von den Franzosen wurden 8 Gribeauval-Lafetten vor Ort gebaut, der Anteil sächsischer Walllafetten bleibt unklar. Sächsische Mörser sind seitens der Belagerer am Fort Zinna und an der Teichschanze nachgewiesen; ebenso eine Batterie von 12 Pfündern am Fort Zinna – somit verwendeten die belagernden Preußen und verteidigende Franzosen sächsisches Artilleriematerial.
Prof. Dr. Volker Schmidtchen (Dortmund) machte in seinem Vortrag deutlich, dass auch schon zur Zeit Friedrich des Großen „Technik“ im Zusammenhang mit dem Kriegswesen weitaus mehr umfasste als Bewaffnung und sonstige Ausrüstung der Streitkräfte. Dazu zählten das beherrschte technologische Know how, die Träger dieses Wissens und ihre Befähigung zur praktischen Umsetzung, die Kapazitäten der Produktionsstätten, die Eigenerzeugung von Rohstoffen, wie der Grad der Abhängigkeit von entsprechenden Importen, Bestand und technische Qualität der bei der Armee vorhandenen Waffenausstattung sowie die Arbeitsorganisation und das System der Versorgung der Truppen mit allen für die Kriegführung erforderlichen Gütern.
Der „Soldatenkönig“ Friedrich Wilhelm I. hat nie einen Krieg geführt. Sein Sohn Friedrich II. erlangte in den von ihm geführten Kriegen nicht nur den Ruhm als überaus erfolgreicher Feldherr, sondern auch als Schöpfer einer neuen europäischen Großmacht. Beide aber haben vor allem auch durch ihre wirtschaftspolitischen Maßnahmen die Grundlagen für diesen Aufstieg Preußens gelegt, indem sie durch die gezielte Förderung eigener Rüstungsbetriebe, durch den Ausbau des Hüttenwesens und das Anwerben ausländischer Spezialisten die kriegswichtigen Elemente der Wirtschaft des Landes stärkten und die Abhängigkeit von fremden Märkten für solche Güter in beträchtlichem Maße verringerten.
Der Vater von Friedrich II. hatte in einer 27jährigen Friedensperiode den Umfang des preußischen Heeres von 30.000 auf 80.000 Mann gesteigert, den Unterhalt dafür ohne übermäßige Verschuldung aufbringen und ihm noch eine gut gefüllte Staatskasse hinterlassen können. Nach 46jähriger Regierungszeit, von denen exakt die erste Hälfte durch die drei sieg- aber auch verlustreichen Schlesischen Kriege und die zweite durch einen beispiellosen Wiederaufbau des Landes geprägt gewesen war, wies die staatliche Handelsbilanz Friedrich II., mittlerweile „Alter Fritz“ genannt, bei dessen Tod einen Gewinn von ökonomisch sehr gesunden 4 Millionen Talern aus.
Dr. Thomas Lindner (Windhagen), Herausgeber des nach 1945 verschollen angenommenen Eberhard Kessel-Manuskriptes über die letzte Phase des 7-jährigen Krieges, führte aus:
Die Schlacht bei Torgau am 3. November 1760 zählt zu den heute eher weniger bekannten Ereignissen des Siebenjährigen Krieges. Friedrich der Große und der österreichische Feldmarschall Leopold Daun wollten ihre strategische Position in Sachsen festigen und waren unbedingt zum Erfolg entschlossen. Die operative Lage zwang den König, seine Armee zu teilen und auf langen Marschwegen getrennt gegen die österreichischen Linien vorrücken zu lassen. Zudem wich deren Aufstellung erheblich von seiner Disposition ab. Statt im geschlossenen Einsatz musste der König seine Truppen sukzessive ins Gefecht führen und mehrfach unter großen Verlusten die Süptitzer Höhen angreifen. Erst die erfolgreiche Umgruppierung und Verschiebung des von Süden angreifenden Korps Zieten brachte gegen Abend den unerwarteten Erfolg. Deutlich zeigten sich bei Torgau die Grenzen einer effektiven Gefechtsaufklärung sowie der Kommunikation, die den Armeen des Ancien régime gesetzt waren. Dass die Preußen schließlich trotz ihrer verheerenden Verluste die Schlacht dennoch zum Erfolg wenden konnten, war wesentlich ihrer Entschlossenheit und der taktischen Beweglichkeit vieler Unterführer zu danken, für die später der Begriff des Führens mit Auftrag geprägt wurde.
Folgend einige weiterführende Anmerkungen von Dr. Lindner, die wir hier mit zur Kenntnis geben wollen:
Mit der Formulierung „Umgruppierung und Verschiebung“ ist die doppelte Führungsleistung Zietens am Nachmittag des 3. Nov. 1760 gemeint. Zieten löste sich ja ab etwa 16:00 Uhr vom Gegner und verschob seine Truppen zunächst brigadeweise nach links in Richtung auf den Südrand von Süptitz zu. Dies führte zugleich zu einer weitgehenden Umgruppierung, denn nunmehr sind für den späteren Angriff aus dem Defilee der Schafteiche heraus Infanteriekräfte vorn (nicht mehr Kavallerieverbände, wie zunächst auf dem Marsch am Morgen auf Torgau zu) die zudem auch nicht mehr in der ursprünglichen Aufstellung fochten (die Brigade Tettennorn kämpfte z. B. zunächst gemeinsam mit der Brigade Salderb in Süptitz und in den Süptitzer Weinbergen, anschließend rückte die Brigade Saldern gefolgt von der Brigade Grumbkow ihrerseits als erste in Marschkolonne an den Schafteich vor).
Das bedeutet, dass mit hängender oder verschobener Gefechtsordnung m. E. die viel beschriebene „schiefe Schlachtordnung“ Friedrich des Großen bezeichnet ist, also die Schwerpunktbildung auf einer Flanke des Gegners, um an dieser Stelle die Linie aufzubrechen oder zu überflügeln und sie anschließend von der Seite her aufzurollen. Torgau hat man gelegentlich wegen der Teilung der Preußischen Armee als Höhe- und Endpunkt der „schiefen Schlachtordnung“ bezeichnet.
Dr. Lindner zeigte sich diesbezüglich eher etwas skeptisch, da der operative Ansatz bei Torgau sicher mehr der schwierigen Ausgangslage geschuldet war, und der so nicht geplante, beinahe katastrophale Verlauf der Schlacht für die preußischen Truppen sprach ebenfalls gegen ein solches Verhältnis.
Erkenntnisleitendes Interesse bei der kriegs- und operationsgeschichtlichen Betrachtung der Schlacht bei Torgau war grundsätzlich die Ranke´sche Frage danach, „wie es eigentlich gewesen ist“. Über das konkrete Nachvollziehen des Planungs- und Gefechtsgeschehens bei Torgau gelangt man zu übergeordneten Fragestellungen der Differenz zwischen den Theoremen absolutistischer Kriegführung und der Praxis in einer gegebenen operativen Lage. Die Teilung der Preußischen Armee und der letzte Angriff des Korps Zieten bereits in der Dunkelheit loten die Grenzen der bisherigen Lineartaktik der Armeen im Ancien régime aus, ohne sie zu dieser Zeit bereits überwinden zu können.
Mit anderen Worten:
Die Truppen griffen dann später auf den Süptitzer Höhen teils aus der Bewegung, vermutlich tief gestaffelt als Kolonne an, teils sicherlich auch in aufgelöster Ordnung. Dies ist jedoch nicht wie dann in der napoleonischen Zeit einer weiter entwickelten Taktik geschuldet, sondern den besonderen Umständen der Lage, die eine Entwicklung der Zietenschen Truppen zur Linie aus vielfältigen Gründen nicht zuließ.
Prof. Dr. Stefan Kroll (Rostock) sprach über “Die Kursächsische Armee während der drei Schlesischen Kriege (1740–1763)”.
Innerhalb des Reiches besaß Kursachsen während der längsten Zeit des 18. Jahrhunderts nach Österreich und Preußen die zahlenmäßig drittstärkste Armee. Im Mittelpunkt des Vortrags von Stefan Kroll standen der Lebensalltag und die Kriegserfahrungen von kursächsischen Unteroffizieren und Soldaten in den drei Schlesischen Kriegen (1740/42, 1744/45 und 1756/63). Anhand zahlreicher Beispiele verdeutlichte der Rostocker Historiker, der Teilergebnisse seiner Habilitationsschrift vorstellte, dass die Truppen unter dem Strich weitaus stärker durch Krankheiten, Seuchen und die Folgen von Versorgungsengpässen als durch die Auswirkungen direkter Kampfhandlungen bedroht waren. Für viele der sächsischen Soldaten bedeuteten die Schlesischen Kriege nicht viel mehr als einen ständigen Kampf um das eigene Überleben.
Prof. Dr. Jürgen Kloosterhuis (Berlin) befasste sich mit dem Thema: „Ordre, Eintrag und Porträt. Identitätsstiftung und Traditionsbildung im preußischen Offizierkorps des 18. Jahrhunderts im Spiegel seiner Schrift- und Bildquellen“. Der Vortragende rückte die Begriffe „Identifikation“ und „Tradition“ ins Zentrum seiner Ausführungen. Tradition bedeutet, dass etwas „so war, so ist und so sein wird“.
Die Identifikation der Soldaten mit der Sache erfolgte über Gewöhnung, Befehl, Kameradschaft und über die (relative) Sicherheit und Stärke der geschlossenen Formation. Bei den Preußen spielte die Gefolgschaft, die der charismatischen Figur galt, eine wichtige Rolle Friedrich des Großen.
In der Podiumsdiskussion kamen zu dieser Thematik, speziell zum Begriff „Motivation“ noch folgende Hinweise:
Eine ideologische Motivation, für die man kämpfte – für ein Vaterland oder bestimmte Werte – kann zumindest für Mannschaften und Unteroffiziere nicht festgestellt werden. Militärische Tradition beginnt sich im Verlauf des 18. Jahrhunderts in Preußen zunächst im Rahmen einer sich herausbildenden Regimentstradition zu entwickeln. Sie ist Bestandteil militärischen Zusammenhalts und damit in letzter Konsequenz auch einsatzrelevant.
Die Bundeswehr versteht Tradition als wertebezogene Auswahl aus der Geschichte. Sie hat in diesem Verständnis drei Säulen als Grundlage ihres Traditionsverständnisses definiert: Die preußischen Militärreformen Scharnhorsts und Gneisenaus, den militärischen Widerstand gegen Hitler und das NS-Regime sowie die Tradition der Bundeswehr als erster Wehrpflichtarmee in einem demokratischen Deutschland einschließlich ihrer Einsätze.
Die Exkursionen führten auf das Schlachtfeld (Süptitzer Höhen) der Schlacht bei Torgau; hier erfolgten Erläuterungen durch Dr. Lindner. Am Denkmal der Schlacht wurde der Gefallenen gedacht.
Am nächsten Tag waren das Fort Zinna und der Brückenkopf der Festung Torgau das Ziel der Exkursion. Ausführungen hierbei wurden durch Norbert Lange, Manfred Dauer, Klaus Lotzenburger vorgenommen.
Dr. Uwe Niedersen
Die Berichterstattung von Torgau-TV finden Sie hier:
Tagung der Festungsforscher und Historiker am 29., 30. und 31. Oktober 2010 in Torgau