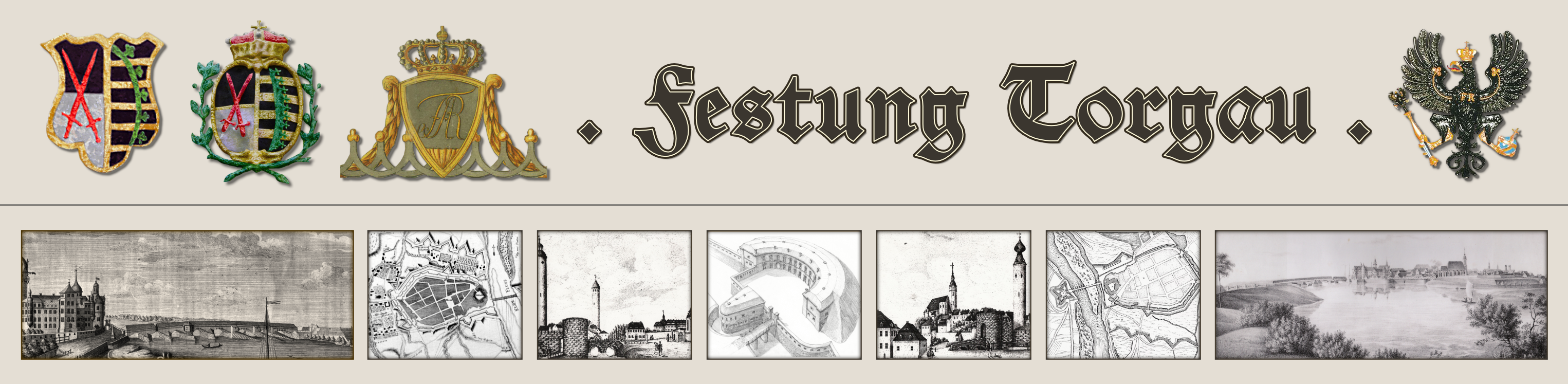
Tagung der Historiker und Festungsforscher
Torgau/Elbe, 13. und 14. Mai 2011
Erhaltung und Nutzung von Festungen des 19. Jahrhunderts
Ort: Schloss Hartenfels, Plenarsaal, Flügel D (Innenhof), 2. Etage
R e s ü m e e
Die 11. Tagung der Festungsforscher und Historiker wurde zum Thema: „Erhaltung und Nutzung von Festungen des 19. Jahrhunderts“ vom Förderverein Europa Begegnungen e. V. und seinem Sachsen-Preußen-Kollegium in Torgau, im Schloß Hartenfels, am 13. und 14. Mai 2011 durchgeführt.
In die Tagungsmappe wurden, neben der Adressenliste und dem Tätigkeitsprofil der Teilnehmer, folgende Stücke beigefügt:
- Renvoi für die Festung Torgau, 1823, erstellt von dem preußischen Ing.-Leutnant Westphal
- Torgau – Entwicklung einer Stadt (Kurzfassung), Dr. Hansjochen Hancke
Im Tagungssaal befanden sich der Büchertisch mit aktueller Literatur zum Tagungsthema. Der Veranstalter der Tagung, der Förderverein Europa Begegnungen e. V., konnte zur Tagung wiederum eine neue Schrift vorstellen und herausgeben:
„Sächsische Heimatblätter, 1/2011“, ein thematischer Band mit neueren Forschungsresultaten zum Thema „200 Jahre Sächsische Elb- und Landesfestung Torgau, Edikt vom November 1810 und 250 Jahre Schlacht bei Torgau, 3. November 1760“, 106 Seiten und 133 Abbildungen.
Zum Thema „Festung Torgau“ können außerdem folgende Bände beim Veranstalter bezogen werden:
- Die Festung Torgau. Der Brückenkopf, 2. erweiterte Auflage, Oktober 2010, 80 S., mit 90 Abb., davon über die Hälfte in Farbe;
- Die Festung Torgau. Fort Zinna, Mai 2010, 60 S. mit 50 Abb., davon 35 in Farbe.
In Arbeit befindet sich das Buch „Führungen durch die Festung Torgau“; es soll im Juli 2011 erscheinen; Autor: U. Niedersen.
Im Veranstaltungsraum fanden die Posterstände zu folgenden Themen Aufmerksamkeit:
- Dr. Klaus Landschreiber und Detlef Arlt: Torgau-Festungselemente in alten Ansichten
- Gerhard F.H. Schult und Dr. Horst Schumann: Festung Wittenberg; Nutzung des Brückenkopfes als Hotel
- Dipl.-Ing. Karsten Grobe: Petersberg sowie Entwurfszeichnungen mit Nutzungsbeispielen aus Erfurt.
Die Ausstellung „Carl Heinrich Aster und die Abbildungen der Chur-Sächsischen Truppen in ihren Uniformen unter der Regierung Friedrich August III. von Carl Adolpheinrich Hess, 1805 und 1806“, wurde durch Herrn Dipl.-Ing. Jörg Titze fachlich betreut.
Die Stiche dafür erhielt der Veranstalter von Ernst-Ludwig von Aster (Oyten, Niedersachsen).
Folgend werden einige Inhalte aus den Vorträgen mitgeteilt:
Dr. habil. Uwe Niedersen (Torgau, Freistaat Sachsen) behandelte das Thema „Heute noch vorhandene Elemente der Festung Torgau“ aus der Sicht, Möglichkeiten der Systematik der Teile der Festung Torgau vorzustellen.
In einem ersten Schritt wurde wie folgt eingeteilt:
1. Alles, was vor dem Hauptwall der Stadtbefestigung liegt.
2. Der Hauptwall selbst sowie alles, was im Wall und unmittelbar am Wall errichtet wurde.
3. Alles, was hinter dem Hauptwall an nichtkasemattierten Gebäuden zu finden ist.
Diese einfache Einteilung wurde mit dem „Renvoi für die Festung Torgau“, erstellt durch den preußischen Ingenieur-Leutnant Westphal, 1823, verglichen.
Westphal gliederte in:
1. Festungswerke, a) Der Hauptwall, b) Außenwerke, Batardeau, Schleusen;
2. Gebäude, a) Tore, kasemattierte Gebäude, Poternen etc. b) Königliche, nichtkasemattierte Gebäude, c) Öffentliche Zivilgebäude.
Vor- und Nachteile verschiedener Klassifizierungen wurden diskutiert. Für eine Begehung der vorhandenen Elemente der Festung Torgau wurden vom Referenten fünf Führungen mit folgender Systematik vorgeschlagen:
A. Außenwerke, I. Brückenkopf, Elbelünetten, Tambourierung der Eisenbahnbrücke; II. Fort Zinna, Großer Teich, Schleusenlünette I, Inundation, Glacis.
B. Hauptwerk, III. Königs-Tor, Poternen, Laboratorium, Flankenkasematten der Bastionen III, II, I, Körnermagazin; IV. Batardeau, Ober- und Unterhafenanlage, Futtermauer am Elbufer, Flankenkasematte der Bastion VII.
C. Gebäude hinter dem Wall, V. Schloß Hartenfels als Reduit, Magazine, Kasernen, Lazarette, Amts- und Wohngebäude sowie auch Grabstätten und Denkmäler.
Dr. Steffen Delang (Dresden, Freistaat Sachsen) erläuterte die erfolgten Aktivitäten zur Erhaltung der verbliebenen Elemente der Festung Torgau unter dem Titel: „Die Festung Torgau – denkmalpflegerische Tätigkeit an ihren erhaltenen Bauwerken“. Er führte aus:
Die zielgerichtete denkmalpflegerische Beschäftigung mit den umfänglichen Überresten der Festung Torgau leiteten Peter Findeisen und Heinrich Magirius mit ihrem Inventarband: Die Denkmale der Stadt Torgau, Leipzig 1976 ein.
Während der 1980er und der 1990er Jahre standen die Sanierung und Restaurierung der bedeutsamen Wohnbausubstanz in der Stadt sowie das Schloss und die Marienkirche im Vordergrund der Bemühungen.
Nach der Jahrhundertwende und dem weitgehenden Abschluss der wichtigsten Sanierungsvorhaben, nach der Etablierung der „Residenzstadt der Renaissance“ im öffentlichen Bewusstsein rückten die Festungsanlagen als Desiderat stärker in den Mittelpunkt denkmalpflegerischer Bemühungen.
Der überwiegende Teil der erhaltenen Festungsbauten wirkten prägend im Stadtbild, vor allem der Brückenkopf und das Glacis, aber die meisten Baulichkeiten wiesen erhebliche Mängel auf und waren nicht präsentabel.
Es gab keine umfassende und präzise Bestandserfassung mit Ausnahme des Glacis, und es existieren keine verbindlichen Planungen für die Zukunft.
Trotzdem gab es punktuell hervorhebenswerte Sanierungen und Umnutzungen von Teilen der Festung, so z.B. der Mauern entlang der Elbe, in der Bastion II (Kulturbastion), am Batardeau am Niederhafen, an der Eisenbahnbrücke sowie im Brückenkopf (Poterne).
Dipl.-Ing. Katharina Baumgart (Berlin) referierte zum Thema: „Das Glacis in Torgau“.
Der Vortrag behandelte die Wandlung der Flächen des Torgauer Glacis von seiner fortifikatorischen
Funktion als Festungsvorfeld hin zu einer die Altstadt umspannenden Grünanlage.
Im Wesentlichen sind gemäß der Referentin drei Phasen in der Entwicklung des Glacis voneinander zu unterscheiden:
Phase 1 - Festungszeit von 1810 bis 1893
Phase 2 - Entfestigung und Wandlung des Glacis in einen Stadtpark - 1893 bis 1945
Phase 3 - 1945 bis heute.
Die drei Phasen seien hinsichtlich der Glacisnutzung sehr verschieden. Zunächst diente das Glacis
vorrangig der Verteidigung. Der Gehölzbestand wurde nach rein fortifikatorischen Gesichtspunkten
entwickelt. In der Festungszeit wurde die äußere Grenze des Glacis mit der Regulierung des Schwarzen Grabens und der Ausdehnung der Inundationsbecken abgesteckt. Auch das Haupt-Wegesystem entstand bereits in der Festungszeit (Wege zu den Schleusenlünetten und der „Glacisweg“). Ab 1850 wurde das Glacis zum Spazierengehen von den Torgauer Bürgern genutzt. Damals begann man, die Vegetation auch nach gestalterischen Aspekten zu bearbeiten. Allerdings verlor die Anlage mit dem „Rasieren“ im Jahr 1866 in fast allen Bereichen seinen Gehölzbestand.
Mit Aufhebung der Festung 1889 wurde das Glacis in einen Stadtpark umgewandelt. Man legte neue Wege an, führte Pflegemaßnahmen am Gehölzbestand durch und richtete Sitzbereiche ein. In den 1920er Jahren kamen Denkmale für Gefallene des Ersten Weltkrieges hinzu.
Insbesondere das Wegesystem zeigt, dass im Glacis keine radikalen Umformungen stattfanden, sondern hauptsächlich Ergänzungen für eine bessere Nutzbarkeit vorgenommen wurden.
Am intensivsten gestaltet war das Glacis wohl kurz vor dem Zweiten Weltkrieg, da in dieser Zeit noch der Reitweg sowie mehrere später verloren gegangene Wegeabschnitte vorhanden waren. In der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg wurden einige gestalterisch motivierte Veränderungen/Ergänzungen vorgenommen. Dazu zählen die Errichtung des Denkmals der Begegnung an der Elbe sowie der Bau der Kriegsgräberanlage mit Denkmal.
Dipl.-Bibl. Markus Theile (Ulm, Baden-Württemberg) sprach zur Erhaltung und Nutzung der Bundesfestung Ulm: „Gestern Verkehrshindernis, heute Vereinsheim, morgen Touristenmagnet?“ Er informierte:
Die Bundesfestung Ulm ist eine der fünf gemeinsamen Festungen des Deutschen Bundes. Ulm war damals Straßenknotenpunkt und wichtiger Donauübergang. Aufgrund der großen Bedeutung wurde die Stadt Zentralfestung für Süddeutschland und verschanztes Lager für bis zu 100 000 Mann
Die Bundesfestung wurde in den Jahren 1842 bis 1859 erbaut. Nach dem Ende des Deutschen Bundes und dem Sieg über Frankreich 1871 erhielt Ulm den Status einer Reichsfestung. Modernisierungen und Erweiterungen folgten bis 1887. Die letzten Anlagen entstanden in den Jahren 1901 bis 1914, obwohl ihre Bedeutung mit dem Ausbau der Oberrheinbefestigungen immer mehr schwand.
Heute stellt die Bundes- und Reichsfestung Ulm/Neu-Ulm den größten Bestand an Festungswerken des 19. Jahrhunderts in Deutschland dar. Mehrere Kilometer Hauptumwallung, nahezu der gesamte Außenfortgürtel und mehrere Betonwerke der letzten Ausbauphase stehen heute noch.
Nachdem die militärische Nutzung der Festungswerke 1945 weitgehend endete, durchlebten die Anlagen das selbe Schicksal, wie in vielen anderen Festungsstädten: Notwohnungen und Kleinbetriebe zogen ein. Tore wurden als Verkehrshemmnis empfunden und viele Bauten abgerissen. Erst in den 1970er Jahren setzte langsam ein Umdenken ein: Vereine entdeckten die großartigen Gewölbebauten für sich - trotz oft fehlender finanzieller Unterstützung. Auch der Förderkreis Bundesfestung entstand in diesen Jahren. Seit 35 Jahren setzt er sich für den Erhalt, die Pflege, Präsentation und Dokumentation ein. Dem Engagement seiner Mitglieder ist es zu verdanken, dass die Festung heute in den Stadtverwaltungen und Bevölkerung positiv wahrgenommen wird und ihre Werke bei zahlreichen Veranstaltungen erlebt werden können.
Der Vortrag zeigte anhand mehrerer Beispiele die unterschiedliche Wahrnehmung der Festung in der Zeit wie auch die Entwicklungen bis in die Gegenwart. Ziel ist, die Bundesfestung Ulm als Anziehungspunkt für Touristen attraktiv zu machen.
Dipl.-Ing. Karsten Grobe (Erfurt, Freistaat Thüringen) konnte mit seinem Vortrag „Beispiele zur Erhaltung und Nutzung von Festungsbauwerken des 19. Jh. in Erfurt“ auf die enormen Fortschritte bei der Erhaltung von Festungsbauwerken in Erfurt verweisen. Er leitete wie folgt ein:
Nach Niederlage und Abzug der französischen Truppen im Jahr 1814 wurden auch die Zitadellen Petersberg und Cyriaksburg in Erfurt einer grundlegenden Sanierung und Modernisierung unterzogen. Dabei versah man vorhandene Festungsgebäude mit „bombensicheren“ Dächern bzw. Decken. Diese Decken kamen ab 1822 noch als dicht gelagerte Holzbalkendecke unter einen flachen Satteldach zur Ausführung.
Ab 1826 erfolgte der obere Gebäudeabschluss mit einem massiven Gewölbe aus Kalkbruch- bzw. Ziegelsteinen. Auf diese Gewölbe wurde zusätzlich noch eine ca. 1,20 m dicke „bombensichere“ Erddeckung aufgetragen.
Anhand einer Reihe einzelner Beispiele zeigte der Autor Lösungen bei der Sanierung und denkmalgerechten Nutzung von Festungsbauwerken aus dem 19. Jh., die durchaus als Anregung dienen können.
Im Vortrag wurden u.a. Kasernen, Pulvermagazine , Zisternen, Kriegsbäckereien, Latrinen usw. behandelt.
Dipl.-Päd. Rainer Haschke (Dresden, Freistaat Sachsen) führte in seinem Vortrag: „Von der Festung Dresden zum Touristenmagneten“ über die Anfänge der Befestigung Dresdens aus. Er berichtete weiter über die nach der Wende (1990) erfolgten Grabungen des dortigen Vereins, um den noch vorhandenen Festungsbestand nachzuweisen und zu erhalten.
Zu einigen Inhalten:
Vermutlich im Zusammenhang mit der Errichtung einer Elbbrücke entstand um 1170 am linkselbischen Flussufer die Stadt Dresden. 1206 wird sie erstmalig urkundlich erwähnt. Zum Schutz gegen feindliche Angriffe errichtete man bald eine Stadtmauer aus Plänersteinen mit Stadttoren. Im Zusammenhang mit den Hussitenkriegen erfolgte im 15.Jh. und der Einsatz von Feuerwaffen erzwang wesentliche Veränderungen der mittelalterlichen Stadtbefestigung. Herzog Moritz hat seine Residenz in der Mitte des 16. Jhs. mit Wallanlagen in Altitalienischer Manier umgeben. Dresden dürfte die erste auf diese Weise geschützte Stadt in Deutschland gewesen sein. Der schlecht befestigte rechtselbische Stadtteil erhielt im 17. Jh. eine ausgedehnte Befestigung in Niederländischer Manier. Damit konnte Dresden allen Angriffen widerstehen. Mitte des 18.Jh. zeigten sich erste Verfallserscheinungen.
Dennoch scheiterte Friedrich II von Preußen im Siebenjährigen Krieg im Juli 1760 an den Bollwerken der Stadt.
Dafür nahm er die Stadt unter ein Dauerbombardement sodass man von einem Terrorangriff sprechen muss.
Fast zwei Drittel aller Häuser der Stadt brannten nieder Der Wiederaufbau dauerte 50 Jahre! Erst der Verzweiflungsausbruch österreichischer Soldaten war erfolgreich und endete mit dem Vernageln mehrerer Dutzend preußischer Kanonen und mit 300 gefangenen preußischen Kanonieren. Die Festung hatte sich gehalten.
Durch den militärischen Fortschritt der Angriffswaffen überholt, beseitigte man zu Beginn des 19. Jh. große Teile der Anlage. Daran änderte auch die kurzzeitige Fortifikation unter Napoleon 1813 nichts.
Nach 1815 erfolgte die nahezu vollständige Schleifung (etwa 1830 abgeschlossen)bis auf den Mauerrest der heutigen Brühlschen Terrasse. Mit der „Brühlschen Terrasse“ besitzt Dresden einen bedeutenden Rest einer Befestigungsanlage aus dem 16. Jh.. Seit 1814 ist sie für die Bevölkerung zugänglich. Vor allem wegen der beeindruckenden Aussicht besuchen sie Touristen gern. Der militärische Charakter der Flaniermeile wurde völlig verdrängt.
Ende des 20. Jh. gab es mehrere Bürgerinitiativen, die die vermuteten Räume unter der Terrasse vom Schutt der Jahrhunderte befreien wollten. Sie endeten meist mit dem Verbot der Initiative und aller Grabungen.
Erst das Wohlwollen der End-DDR Behörden beschied der Initiative von 1990/91 einen Erfolg.
Die Größe der Aufgabe führte zu zielstrebigen Grabungen, und zur Gründung des Dresdner Vereins Brühlsche Terrasse e.V. am 25. Januar 1991.
Führungen und die tägliche Öffnung seit 1993 führten dazu, dass sich Tausende Besucher (wohl um die 400.000) von der einstigen Wehrhaftigkeit der Stadt überzeugen konnten. Erst die vertrauensvolle Zusammenarbeit des Dresdner Vereins Brühlsche Terrasse e.V. mit dem Eigentümer, den Staatlichen Schlössern und Gärten Sachsens brachte uns in der Öffentlichkeit die breite Anerkennung.
Jürgen Huck, M.A. (Wolfenbüttel, Niedersachsen) stellte dem Auditorium seine Stadt unter dem Thema vor: „Wolfenbüttel – Die Geschichte der ehemaligen Residenzfestung und die Bewahrung ihrer Reste“. Er trug vor:
Wolfenbüttel, damals wohl eine Wasserburg, wurd anfangs des 12. Jahrhunderts erstmals als Name der Herren von WF. genannt. Die Burg, als Reichlehen behandelt, wurde den Herren von WF. 1255 von König Wilhelm von Holland aberkannt und kam in den Besitz der Herzöge des 1235 gebildeten Herzogtums Braunschweig – Lüneburg, das durch Erbteilung bald in Teilfürstentümer zerfiel. Deren Herren blieben aber gemeinsam Stadtherren Braunschweigs, das zunächst Residenz des Fürstentums Braunschweig – Wolfenbüttel blieb. Auseinandersetzungen mit der die Reichsfreiheit anstrebenden Hansestadt führten 1432 zur Verlegung der Residenz nach WF.
Als rondellierte Festung Hzg. Heinrichs d. J. abgebildet wird sie erstmals 1542 von Lucas Cranach d. Ä. anläßlich der Einnahme durch den Schmalkaldischen Bund. 1575 ging Hzg. Julius zum Ausbau zu einer bastionierten Festung nach dem von Specklin überlieferten „Straßburger Plan“ über; sie sollte ein große Handels- und Universitätsstadt aufnehmen. Kostengründe verursachten eine Aufgabe des Planes und die Inkaufnahme von Mängeln im Grundriß.
Im Dreißigjährigen Krieg zweimal (1627 und 1641) durch Anstauung der Oker überschwemmt, wurde die Festungsstadt nach 1650 letztmalig modernisiert. Die Unterwerfung Braunschweigs 1671 führte 1754 zur Rückverlegung der Residenz. Die vernachlässigte Festung unterlag 1761 einem sächsisch- französischen Kontingent. Anfangs des 19. Jahrhunderts wurde sie geschleift.
Die geringen baulichen Reste freizulegen und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, hat ein ehrenamtlicher Arbeitskreis übernommen, der dabei von der Stadt und der Stiftung eines ortsansässigen Unternehmens, aber auch durch Spenden von Besuchern unterstützt wird.
Podiumsdiskussionen wurden jeweils nach den Vorträgen eines Referatetages durchgeführt.
Aufgrund der Tagungsthematik waren neben den Referenten auch der Baudezernent der Stadt Torgau, Herr von Wantoch und die Vertreter des Sächsischen Landesamtes für Denkmalschutz und für Archäologie, die Herren Dr. Delang und Dr. Ender, sowie Herr Dr. Schumann (Wittenberg) am Podiumsgespräch beteiligt.
Diskutiert wurden die Begriffe: Nutzung, Umnutzung, denkmalgerechte Nutzung sowie das Festungsdenkmal an sich in ihrer Anwendung und Wertigkeit für eine Erhaltung und Nutzung von Festungssubstanz.
Die Gespräche ergaben weiter:
Ein Rahmenplan (Musterplan), initiiert etwa durch eine Stadtverwaltung, setze einen theoretischen Vorlauf über die Festung und eine Erfassung der vorhandenen Festungselemente voraus. Desweiteren sollte das Interesse der Bürger der Stadt am Gegenstand vorhanden und in der öffentlichen Meinung eine „Aufbau-Stimmung pro Festung“ zu registrieren sein.
An Beispielen der Festungen Ulm, Erfurt, Dresden, Wolfenbüttel, Wittenberg konnten Vorgehensweisen bei der Erhaltung anschaulich, fasslich und nachvollziehbar dargestellt werden.
Tatsache ist, dass die Erhaltung und Nutzung der Festung Torgau ziemlich am Anfang steht und verschiedene Interessen der Beteiligten den Fortgang momentan erschweren.
Die Exkursion (verantwortlich Norbert Lange; Dr. Uwe Niedersen) wurde im Brückenkopf der Festung Torgau durchgeführt. Den Tagungsteilnehmern, ca. 90 Personen, schlossen sich mehrere interessierte Torgauer Bürger an. Als bedauerlich wurde während der Führung die fehlende Konzeption um die Erhaltung der deutlich gealterten, ja zerfallenden Festungselemente des Brückenkopfes bezeichnet.
Dr. Uwe Niedersen
Die Berichterstattung von Torgau-TV finden Sie hier:
Tagung der Festungsforscher und Historiker am 13. und 14. Mai 2011 auf Schloss Hartenfels in Torgau